Abruf und Rang:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang: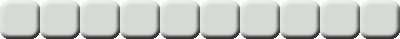 0% (656)
0% (656)
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
BVerfGE 149, 293 - Fixierungen
BVerfGE 147, 253 - numerus clausus III
BVerfGE 146, 294 - Psychischkrankengesetz M-V
BVerfGE 141, 143 - Akkreditierung von Studiengängen
BVerfGE 141, 82 - Partnerschaftsgesellschaft
BVerfGE 138, 296 - Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen
BVerfGE 137, 273 - Katholischer Chefarzt
BVerfGE 134, 141 - Beobachtung von Abgeordneten
BVerfGE 134, 1 - Studiengebühren Bremen
BVerfGE 125, 39 - Adventssonntage Berlin
BVerfGE 119, 309 - Gerichtsfernsehen
BVerfGE 119, 59 - Hufversorgung
BVerfGE 118, 1 - Begrenzung der Rechtsanwaltsvergütung
BVerfGE 117, 244 - CICERO
BVerfGE 117, 163 - Anwaltliche Erfolgshonorare
BVerfGE 113, 29 - Anwaltsdaten
BVerfGE 110, 77 - Rechtsschutzinteresse
BVerfGE 108, 282 - Kopftuch
BVerfGE 107, 299 - Journalistische Verbindungsdaten
BVerfGE 107, 104 - Anwesenheit im JGG-Verfahren
BVerfGE 106, 28 - Mithörvorrichtung
BVerfGE 105, 279 - Osho
BVerfGE 104, 337 - Schächten
BVerfGE 102, 197 - Spielbankengesetz Baden-Württemberg
BVerfGE 99, 129 - DDR-Erbbaurecht
BVerfGE 93, 1 - Kruzifix
BVerfGE 90, 145 - Cannabis
BVerfGE 84, 59 - Mulitple-Choice-Verfahren
BVerfGE 84, 34 - Gerichtliche Prüfungskontrolle
BVerfGE 83, 341 - Bahá'í
BVerfGE 83, 130 - Josefine Mutzenbacher
BVerfGE 83, 1 - Betragsrahmengebühren
BVerfGE 81, 138 - Erledigung der Hauptsache
BVerfGE 80, 367 - Tagebuch
BVerfGE 78, 214 - Unterhaltsleistung ins Ausland
BVerfGE 77, 65 - Beschlagnahme von Filmmaterial
BVerfGE 63, 131 - Gegendarstellung
BVerfGE 54, 148 - Eppler
BVerfGE 52, 223 - Schulgebet
BVerfGE 49, 24 - Kontaktsperre-Gesetz
BVerfGE 45, 400 - Oberstufenreform
BVerfGE 45, 187 - Lebenslange Freiheitsstrafe
BVerfGE 41, 88 - Gemeinschaftsschule
BVerfGE 41, 29 - Simultanschule
BVerfGE 39, 334 - Extremistenbeschluß
BVerfGE 35, 366 - Kreuz im Gerichtssaal
BVerfGE 35, 202 - Lebach
BVerfGE 34, 238 - Tonband
BVerfGE 34, 165 - Förderstufe
BVerfGE 33, 303 - numerus clausus I
BVerfGE 33, 23 - Eidesverweigerung aus Glaubensgründen
BVerfGE 32, 98 - Gesundbeter
BVerfGE 30, 415 - Mitgliedschaftsrecht
BVerfGE 28, 243 - Dienstpflichtverweigerung
BVerfGE 26, 338 - Eisenbahnkreuzungsgesetz
BVerfGE 24, 236 - (Aktion) Rumpelkammer
BVerfGE 21, 139 - Freiwillige Gerichtsbarkeit
BVerfGE 19, 206 - Kirchenbausteuer
BVerfGE 19, 1 - Neuapostolische Kirche
BVerfGE 14, 56 - Gemeindegerichte
BVerfGE 12, 1 - Glaubensabwerbung
BVerfGE 4, 331 - Soforthilfegesetz
BVerfGE 3, 377 - Schwerbeschädigtenschutz
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang:
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
BVerfGE 149, 293 - Fixierungen
BVerfGE 147, 253 - numerus clausus III
BVerfGE 146, 294 - Psychischkrankengesetz M-V
BVerfGE 141, 143 - Akkreditierung von Studiengängen
BVerfGE 141, 82 - Partnerschaftsgesellschaft
BVerfGE 138, 296 - Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen
BVerfGE 137, 273 - Katholischer Chefarzt
BVerfGE 134, 141 - Beobachtung von Abgeordneten
BVerfGE 134, 1 - Studiengebühren Bremen
BVerfGE 125, 39 - Adventssonntage Berlin
BVerfGE 119, 309 - Gerichtsfernsehen
BVerfGE 119, 59 - Hufversorgung
BVerfGE 118, 1 - Begrenzung der Rechtsanwaltsvergütung
BVerfGE 117, 244 - CICERO
BVerfGE 117, 163 - Anwaltliche Erfolgshonorare
BVerfGE 113, 29 - Anwaltsdaten
BVerfGE 110, 77 - Rechtsschutzinteresse
BVerfGE 108, 282 - Kopftuch
BVerfGE 107, 299 - Journalistische Verbindungsdaten
BVerfGE 107, 104 - Anwesenheit im JGG-Verfahren
BVerfGE 106, 28 - Mithörvorrichtung
BVerfGE 105, 279 - Osho
BVerfGE 104, 337 - Schächten
BVerfGE 102, 197 - Spielbankengesetz Baden-Württemberg
BVerfGE 99, 129 - DDR-Erbbaurecht
BVerfGE 93, 1 - Kruzifix
BVerfGE 90, 145 - Cannabis
BVerfGE 84, 59 - Mulitple-Choice-Verfahren
BVerfGE 84, 34 - Gerichtliche Prüfungskontrolle
BVerfGE 83, 341 - Bahá'í
BVerfGE 83, 130 - Josefine Mutzenbacher
BVerfGE 83, 1 - Betragsrahmengebühren
BVerfGE 81, 138 - Erledigung der Hauptsache
BVerfGE 80, 367 - Tagebuch
BVerfGE 78, 214 - Unterhaltsleistung ins Ausland
BVerfGE 77, 65 - Beschlagnahme von Filmmaterial
BVerfGE 63, 131 - Gegendarstellung
BVerfGE 54, 148 - Eppler
BVerfGE 52, 223 - Schulgebet
BVerfGE 49, 24 - Kontaktsperre-Gesetz
BVerfGE 45, 400 - Oberstufenreform
BVerfGE 45, 187 - Lebenslange Freiheitsstrafe
BVerfGE 41, 88 - Gemeinschaftsschule
BVerfGE 41, 29 - Simultanschule
BVerfGE 39, 334 - Extremistenbeschluß
BVerfGE 35, 366 - Kreuz im Gerichtssaal
BVerfGE 35, 202 - Lebach
BVerfGE 34, 238 - Tonband
BVerfGE 34, 165 - Förderstufe
BVerfGE 33, 303 - numerus clausus I
BVerfGE 33, 23 - Eidesverweigerung aus Glaubensgründen
BVerfGE 32, 98 - Gesundbeter
BVerfGE 30, 415 - Mitgliedschaftsrecht
BVerfGE 28, 243 - Dienstpflichtverweigerung
BVerfGE 26, 338 - Eisenbahnkreuzungsgesetz
BVerfGE 24, 236 - (Aktion) Rumpelkammer
BVerfGE 21, 139 - Freiwillige Gerichtsbarkeit
BVerfGE 19, 206 - Kirchenbausteuer
BVerfGE 19, 1 - Neuapostolische Kirche
BVerfGE 14, 56 - Gemeindegerichte
BVerfGE 12, 1 - Glaubensabwerbung
BVerfGE 4, 331 - Soforthilfegesetz
BVerfGE 3, 377 - Schwerbeschädigtenschutz
1. Die Rechtsreferendaren auferlegte Pflicht, bei Tätigkeiten, bei denen sie als Repräsentanten des Staates wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden könnten, die eigene Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft nicht durch das Befolgen von religiös begründeten Bekleidungsregeln sichtbar werden zu lassen, greift in die von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verbürgte individuelle Glaubensfreiheit ein.
| |
2. Als mit der Glaubensfreiheit in Widerstreit tretende Verfassungsgüter, die einen Eingriff in die Religionsfreiheit im vorliegenden Zusammenhang rechtfertigen können, kommen der Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates, der Grundsatz der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und mögliche Kollisionen mit der grundrechtlich geschützten negativen Religionsfreiheit Dritter in Betracht. Keine rechtfertigende Kraft entfalten dagegen das Gebot richterlicher Unparteilichkeit und der Gedanke der Sicherung des weltanschaulich-religiösen Friedens.
| |
3. Die Verpflichtung des Staates auf Neutralität kann keine andere sein als die Verpflichtung seiner Amtsträger auf Neutralität, denn der Staat kann nur durch Personen handeln. Allerdings muss sich der Staat nicht jede bei Gelegenheit der Amtsausübung getätigte private Grundrechtsausübung seiner Amtsträger als eigene zurechnen lassen. Eine Zurechnung kommt aber insbesondere dann in Betracht, wenn der Staat -- wie im Bereich der Justiz -- auf das äußere Gepräge einer Amtshandlung besonderen Einfluss nimmt.
| |
4. Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege zählt zu den Grundbedingungen des Rechtsstaats und ist im Wertesystem des Grundgesetzes fest verankert, da jede Rechtsprechung letztlich der Wahrung der Grundrechte dient. Funktionsfähigkeit setzt voraus, dass gesellschaftliches Vertrauen nicht nur in die einzelne Richterpersönlichkeit, sondern in die Justiz insgesamt existiert. Ein "absolutes Vertrauen" in der gesamten Bevölkerung wird zwar nicht zu erreichen sein. Dem Staat kommt aber die Aufgabe der Optimierung zu.
| |
5. Anders als im Bereich der bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule, in der sich gerade die religiös-pluralistische Gesellschaft widerspiegeln soll, tritt der Staat dem Bürger in der Justiz klassisch-hoheitlich und daher mit größerer Beeinträchtigungswirkung gegenüber.
| |
6. Das Verwenden eines religiösen Symbols im richterlichen Dienst ist für sich genommen nicht geeignet, Zweifel an der Objektivität der betreffenden Richter zu begründen.
| |
7. Das normative Spannungsverhältnis zwischen den Verfassungsgü | |
8. Angesichts der konkreten Ausgestaltung des verfahrensgegenständlichen Verbots kommt keiner der kollidierenden Rechtspositionen vorliegend ein derart überwiegendes Gewicht zu, das verfassungsrechtlich dazu zwänge, der Beschwerdeführerin das Tragen religiöser Symbole im Gerichtssaal zu verbieten oder zu erlauben. Die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rechtsreferendariat in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, ist daher aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren.
| |
Beschluss | |
des Zweiten Senats vom 14. Januar 2020
| |
| -- 2 BvR 1333/17 -- | |
in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde der Frau Dr. E ... -- Bevollmächtigte: 1. ... , 2. ... -- 1. unmittelbar gegen den Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 23. Mai 2017 -- 1 B 1056/17 --, 2. mittelbar gegen § 45 des Hessischen Beamtengesetzes -- HBG -- und den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 -- 2220-V/A3-2007/6920-V --.
| |
Entscheidungsformel: | |
1. Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.
| |
2. Der Antrag auf Auslagenerstattung wird abgelehnt.
| |
Gründe: | |
A. | |
Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist die an die Beschwerdeführerin gerichtete Untersagung, während bestimmter Ausbildungsabschnitte ihres in Hessen abgeleisteten Rechtsreferendariats ein Kopftuch zu tragen. Mittelbar werden die in § 45 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl S. 218, 508 -- HBG) geregelte Neutralitätspflicht sowie der Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 -- 2220-V/A3-2007/6920-V -- zur Prüfung gestellt. | |
1. Das Rechtsreferendariat in Hessen wird im Wesentlichen durch das Gesetz über die juristische Ausbildung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2004 (GVBl I S. 158 -- Juristenausbildungsgesetz, JAG, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. September 2019 [GVBl S. 232]) geregelt. Zum Status und Pflichtenkreis der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare finden sich folgende Vorschriften (jeweils in der bis zum 31. Oktober 2019 geltenden Fassung):
| |
(1) Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben sich der Ausbildung mit vollem Einsatz ihrer Arbeitskraft zu widmen. Im Übrigen gelten für sie die für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf geltenden Bestimmungen mit Ausnahme von die [sic!] §§ 47 und 80 des Hessischen Beamtengesetzes sowie § 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes entsprechend. (2)--(3) ... | |
Das Hessische Beamtengesetz enthält nur wenige ausschließlich auf Beamtinnen und Beamte auf Widerruf bezogene Bestimmungen. Grundsätzlich regelt es die beamtenrechtlichen Verhältnisse einheitlich und unabhängig von der Art des Beamtenverhältnisses. Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf gelten daher insbesondere auch die im Fünften Abschnitt des Zweiten Teils des Hessischen Beamtengesetzes enthaltenen Bestimmungen zur rechtlichen Stellung im Beamtenverhältnis. Die Regelungen sind nach § 2 des Hessischen Richtergesetzes (HRiG) für Richterinnen und Richter sinngemäß heranzuziehen. Die hier verfahrensgegenständliche Vorschrift über die Neutralitätspflicht befindet sich in § 45 HBG und hat folgenden Wortlaut: | |
Beamtinnen und Beamte haben sich im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten. Insbesondere dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Bei der Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 ist der christlich und humanistisch geprägten abendländischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu tragen.
| |
Die Vorschrift entspricht § 68 Abs. 2 in der alten Fassung des Hessischen Beamtengesetzes, der durch das Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität vom 18. Oktober 2004 (GVBl I S. 306, ber. GVBl I 2005 S. 95) eingefügt wurde und seitdem inhaltlich unverändert fortgilt.
| |
2. Nach Erlass des § 68 Abs. 2 HBG a.F. mehrten sich beim Hessischen Ministerium der Justiz Anfragen zum Tragen eines Kopftuchs während des juristischen Vorbereitungsdienstes. Infolgedessen übersandte das Ministerium dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main sowie nachrichtlich den Präsidenten der Landgerichte in Hessen den hier mittelbar angegriffenen Erlass vom 28. Juni 2007, in welchem es bat, künftig wie folgt zu verfahren:
| |
"Wenn aus den Bewerbungsunterlagen für die Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst erkennbar wird, dass während des Vorbereitungsdienstes ein Kopftuch getragen werden soll, sind die Bewerberinnen vor der Einstellung in den Vorbereitungsdienst dahingehend zu belehren, dass sich auch Rechtsreferendarinnen im juristischen Vorbereitungsdienst gegenüber Bürgerinnen und Bürgern politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten haben. Das bedeutet, dass sie, wenn sie während ihrer Ausbildung ein Kopftuch tragen, keine Tätigkeiten ausüben dürfen, bei denen sie von Bürgerinnen und Bürgern als Repräsentantin der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden können. Praktisch bedeutet dies insbesondere, dass Referendarinnen, die ein Kopftuch tragen, -- bei Verhandlungen im Gerichtssaal nicht auf der Richterbank sitzen dürfen, sondern im Zuschauerraum der Sitzung beiwohnen können, -- keine Sitzungsleitungen und/oder Beweisaufnahmen durchführen können, -- keine Sitzungsvertretungen für die Staatsanwaltschaft übernehmen können, -- während der Verwaltungsstation keine Anhörungsausschusssitzung leiten können. | |
II.
| |
1. Die Beschwerdeführerin ist deutsche und marokkanische Staatsangehörige. Sie war seit dem 2. Januar 2017 Rechtsreferendarin im Land Hessen. Nach eigenen Angaben trägt sie als Ausdruck ihrer individuellen Glaubensüberzeugung und Persönlichkeit in der Öffentlichkeit ein Kopftuch. Noch vor Aufnahme der Ausbildung erhielt sie über das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Hinweisblatt, welches inhaltlich den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 wiedergab. Die Beschwerdeführerin erklärte am 7. Dezember 2016 die Annahme des ihr angebotenen Ausbildungsplatzes und merkte an, das Hinweisblatt zur Kenntnis genommen zu haben.
| |
2. Mit Schreiben vom 9. Januar 2017 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die dem Hinweis entsprechende Verwaltungspraxis ein. Mit Schreiben vom 24. Januar 2017 teilte ihr der Präsident des Landgerichts Frankfurt am Main unter Verweis unter anderem auf den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 mit, dass er der Beschwerde nicht abhelfe. Hiergegen stellte die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 10. Februar 2017 beim Verwaltungsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes.
| |
3. Anlässlich dieses verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens überprüfte das Justizprüfungsamt die Erlasslage und das Hinweisblatt. Mit Schreiben vom 6. März 2017 teilte das Justizprü | |
Den Erlass vom 28. Juni 2007 hob das Hessische Ministerium der Justiz -- Justizprüfungsamt -- mit Erlass vom 24. Juli 2017 -- 2220-II/E2-2017/7064-II/E -- auf und wies auf Folgendes hin:
| |
"Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristischen Vorbereitungsdienst haben sich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten. Das bedeutet insbesondere, dass sie keine Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale tragen oder verwenden dürfen, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Für den Vorbereitungsdienst bedeutet dies praktisch, dass Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale in dem oben genannten Sinne tragen, bei Verhandlungen im Gerichtssaal nicht auf der Richterbank Platz nehmen dürfen, sondern nur im Zuschauerraum sitzen können, keine Sitzungsleitungen oder Beweisaufnahmen durchführen dürfen, keine Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft übernehmen dürfen und während der Verwaltungsstation keine Anhörungsausschusssitzung leiten dürfen. Soweit deshalb vorgesehene Regelleistungen durch die Referendarin oder den Referendar nicht erbracht werden, darf dieser Umstand keinen Einfluss auf die Bewertung haben. Das Oberlandesgericht wird gebeten, das bisherige, eigene Hinweisblatt nicht mehr zu verwenden und ab dem Einstellungstermin September 2017 das beiliegende, neue Hinweisblatt während des Verfahrens zur Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst allen Antragstellerinnen und Antragstellern zur Kenntnis zu bringen. Sollten einzelne im Ausbildungsplan vorgesehene Leistungen von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren wegen der Neutralitätspflicht nicht erbracht werden können, ist im Zeugnisformular der Hinweis konnte nicht erbracht werden ohne weitere Zusätze anzu | |
4. Mit Beschluss vom 12. April 2017 -- 9 L 1298/17.F -- verpflichtete das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main das Land Hessen, sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin vorläufig ihre Ausbildung als Rechtsreferendarin vollumfänglich mit Kopftuch wahrnehmen könne und dass sie insbesondere nicht den Beschränkungen unterliege, die sich aus dem Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 ergeben.
| |
Für die der Beschwerdeführerin auferlegten Einschränkungen fehle es an einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage. Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot verpflichteten den Gesetzgeber, die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen selbst zu treffen und nicht der Exekutive zu überlassen.
| |
Durch das Verbot des Tragens des Kopftuchs während wesentlicher Teile des Vorbereitungsdienstes sei eine Einschränkung der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des Art. 4 GG sowie der Berufswahlfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG gegeben. Diesen Belangen stünden mit der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit von Verfahrensbeteiligten und dem im Bereich der Justiz besonders bedeutsamen Grundsatz der staatlichen Neutralität grundrechtliche Freiheitsrechte beziehungsweise grundlegende verfassungsrechtliche Prinzipien gegenüber. Das hierdurch entstehende Konfliktgeflecht erfordere eine legislative Auflösung. Der Gesetzgeber habe mit dem Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität eine ausdrückliche Normierung zur Neutralitätspflicht für Beamte in § 45 HBG und für Referendare im schulischen Vorbereitungsdienst in § 86 Abs. 3 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) geschaffen. Für Rechtsreferendare, die keine Beamte auf Widerruf mehr seien, sondern in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stünden, sei eine derartige Regelung aber nicht erfolgt. Eine Anwendung der Neutralitätspflicht über § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG komme nicht in Betracht. Soweit diese Vorschrift auf § 45 HBG verweise, erfasse sie das Neutralitätsgebot | |
Das Gericht sei zwar der Auffassung, dass sich ein Verbot religiös konnotierter Kleidungsstücke in bestimmen Fällen im Wege einer verfassungskonformen Auslegung des § 45 HBG für die Beamtenschaft beziehungsweise über § 2 HRiG für die Richterschaft herleiten lasse. Aufgrund der Unterschiede in der Amtsführung, bei den Anforderungen an das Amt und den sich aus der Verfassung und dem Gesetz ergebenden Amtspflichten zwischen Beamten und Richtern einerseits sowie Rechtsreferendaren andererseits sei es aber im Hinblick auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit und den Stellenwert der Berufswahlfreiheit unverhältnismäßig, Referendaren in religiös-weltanschaulicher Hinsicht die gleichen Verhaltenspflichten aufzuerlegen wie der dauerhaft tätigen Beamten- und Richterschaft. Zudem bestünden hinreichende Möglichkeiten, den Verfahrensfrieden trotz eines religiös-weltanschaulich motivierten Erscheinungsbildes des Referendars zu bewahren und konkreten Gefährdungen im Einzelfall angemessen zu begegnen, indem seitens der Ausbilder gegenüber den Verfahrensbeteiligten bei der Wahrnehmung der streitgegenständlichen Aufgaben auf die Rechtsstellung als Referendar beziehungsweise als Referendarin hingewiesen werde.
| |
5. Auf die Beschwerde des Landes Hessen hob der Hessische Verwaltungsgerichtshof den Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main mit hier angegriffenem Beschluss vom 23. Mai 2017 -- 1 B 1056/17 -- auf und wies den Antrag der Beschwerdeführerin zurück.
| |
Zur Begründung führte das Gericht aus, eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Anordnung eines Kopftuchverbots für Rechtsreferendarinnen sei mit § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 Satz 1 HBG gegeben. Der Wille des Gesetzgebers, dass gerade auch § 45 HBG für Rechtsreferendare Geltung | |
§ 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 Satz 1 und 2 HBG sei entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts und der Beschwerdeführerin eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage für das Verbot, Ausbildungsleistungen mit unmittelbarem Bürgerkontakt mit Kopftuch wahrzunehmen. Der Hessische Staatsgerichtshof habe in seinem Urteil vom 10. Dezember 2007 -- P.St. 2016 -- entschieden, dass beide Vorschriften mit der Hessischen Landesverfassung vereinbar seien, und in diesem Zusammenhang auch die hinreichende Bestimmtheit bestätigt.
| |
Die Glaubensfreiheit der Beschwerdeführerin sei nicht grenzenlos gewährleistet, sondern werde durch kollidierende Grundrechte anderer Personen und sonstige Verfassungsgüter eingeschränkt. Verfassungsimmanente Schranken der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschwerdeführerin ergäben sich aus der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Verfahrensbeteiligten sowie aus dem staatlichen Neutralitätsgebot als Gemeinschaftswert von Verfassungsrang. Die Abwägung dieser Positionen führe dazu, dass § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 Satz 1 und 2 HBG seitens des Landes Hessen verfassungskonform ausgelegt worden sei und die Beschwerdeführerin die genannten Tätigkeiten nicht durchführen könne.
| |
Die Ausübung des Vorbereitungsdienstes in Form der Übernahme staatlicher Funktionen und der Repräsentation nach außen mit religiös konnotierter Bekleidung verstoße gegen das Neutralitätsgebot in der Justiz. Es sei einem Verfahrensbeteiligten nicht zuzumuten, unter der Glaubens- und Bekenntnissymbolik eines Repräsentanten beziehungsweise einer Repräsentantin des Staa | |
Demgegenüber seien die Nachteile für Rechtsreferendare und konkret für die Beschwerdeführerin dadurch, dass sie vor die Wahl gestellt werde, entweder ihr Kopftuch abzunehmen oder aber nicht auf der Richterbank Platz nehmen und Verfahrenshandlungen vornehmen zu dürfen, von geringerem Gewicht. Der Beschwerdeführerin stehe es frei, der gerichtlichen Verhandlung mit Kopftuch im Zuschauersaal beizuwohnen. Lediglich Verfahrenshandlungen wie Beweisaufnahmen, Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss in der Verwaltungsstation oder Sitzungsvertretungen für die Staatsanwaltschaft dürfe sie mit Kopftuch nicht durchführen. Hieraus entstehe ihr auch kein gravierender Nachteil. Die selbständige Wahrnehmung derartiger Tätigkeiten gehöre nicht zu den nach den §§ 32-34 JAG in der Referendarausbildung verbindlich durchzuführenden Tätigkeiten. Schließlich sei beachtlich, dass in der Praxis nicht selten die Ausbilderin oder der Ausbilder die ihnen zur Ausbildung zugewiesenen Rechtsreferendare nicht mit der Durchführung solcher Tätigkeiten betrau | |
Es sei kaum ein Ort denkbar, an dem die Wahrung staatlicher Neutralität durch ihre Repräsentanten so bedeutsam sei wie vor Gericht, wo die Verfahrensbeteiligten eine in jeder Hinsicht von weltanschaulichen, politischen oder religiösen Grundeinstellungen unabhängige Entscheidung erwarteten. Daher sei dort, wo Rechtsreferendare nach ihrem äußeren Erscheinungsbild als Repräsentanten der Justiz wahrgenommen würden, die hierdurch begründete abstrakte Gefahr für eine Beschädigung des Vertrauens der Verfahrensbeteiligten in die Neutralität des Gerichts und die Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung ausreichend, um Rechtsreferendaren das Tragen religiös konnotierter Kleidungsstücke in dieser Situation zu untersagen. Die Grundrechte der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare hätten nach einer durchzuführenden Abwägung demgegenüber zurückzutreten.
| |
6. Mit Schriftsatz vom 6. Juni 2017 erhob die Beschwerdeführerin Klage beim Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. Das Verfahren ruht derzeit.
| |
III.
| |
Die Beschwerdeführerin rügt mit ihrer am 14. Juni 2017 eingegangenen Verfassungsbeschwerde eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 12 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 sowie von Art. 3 Abs. 1 und 3 GG. Sie beantragt, den Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 23. Mai 2017, den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 sowie das ihr auferlegte Verbot, bei Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenwirkung im Rahmen | |
1. Der Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs greife (in gesteigerter Intensität) in die Ausbildungsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG ein, soweit er ihren Ausschluss als Trägerin eines Kopftuchs von den praktischen Aufgaben der Referendarausbildung unter Bezug auf die "Hinweise" des Hessischen Ministeriums der Justiz als "lediglich einschränkende verfassungskonforme Auslegung" der Neutralitätspflicht der Beamten gemäß § 45 Satz 2 HBG bewerte. Betroffen sei der Aspekt der Berufswahl, vor allem da das ausgesprochene Verbot geeignet sei, andere Absolventinnen des Jurastudiums, die aus religiöser Überzeugung, aus Gründen der Selbstdarstellung oder Würde ein Kopftuch trügen, vom Rechtsreferendariat abzuhalten. An die Rechtfertigung seien damit erhöhte Anforderungen zu stellen.
| |
Es fehle an einer gesetzlichen Grundlage. § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG sei mangels dynamischen Charakters der Verweisung auf das Hessische Beamtengesetz nicht geeignet, den Gesetzesvorbehalt gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG auszufüllen. Ungeachtet der Verweisungsproblematik ergäben sich gravierende verfassungsrechtliche Bedenken gegen § 45 HBG als die Ausbildungsfreiheit einschränkendes Gesetz. § 45 Satz 1 und 2 HBG enthielten die allgemeine, unterschiedslos an alle Beamtinnen und Beamten adressierte, höchst unbestimmte Pflicht, sich "im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten". Nach Satz 3 sei "bei der Entscheidung" über die Neutralitätspflicht "der christlich und humanistisch geprägten Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu tragen". Die hierdurch bedingte Privilegierung der christlich-humanistischen Tradition stehe nicht im Einklang mit dem in Art. 3 Abs. 3 GG niedergelegten Verbot der Benachteiligung beziehungsweise Bevorzugung aus religiösen Gründen. § 45 HBG sei keiner verfassungs- beziehungsweise grundrechtskonformen Auslegung zugänglich. | |
Das ministerielle Schreiben übertrage das Neutralitätsgebot und die Kleidungsvorschrift des § 45 Satz 1 und 2 HBG wörtlich auf den juristischen Vorbereitungsdienst. Die grundrechtlich erhebliche Differenz zwischen einem freiwillig eingegangenen Beamtenverhältnis und einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, das wegen des staatlichen Monopols zwangsweise von allen Bewerberinnen für juristische Berufe zu durchlaufen sei, werde damit zu ihren Lasten eingeebnet. Die gesetzliche wie auch die ministerielle Konkretisierung der Bekleidungsregel für Rechtsreferendarinnen verkenne auch die Differenz von richterlichen und beamtlichen Dienstpflichten. Im Unterschied zu § 45 HBG verwendeten das Grundgesetz und das Deutsche Richtergesetz mit Bedacht nicht den Begriff der Neutralität, sondern vielmehr die Begriffe der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Selbst wenn man Rechtsreferendarinnen bei praktischen Aufgaben als Repräsentantinnen der Justiz den Richterinnen gleichstellen wollte, geböte es ihre Ausbildungsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG, ihre Dienstpflichten an denen von Richterinnen zu orientieren und entsprechend ihrem Ausbildungsverhältnis abzustufen. Die Unterstellung, eine Richterin mit Kopftuch könne den Anforderungen an die Unparteilichkeit oder auch an die Neutralität der Amtsführung nicht gerecht werden, finde weder normativ noch empirisch eine Grundlage.
| |
Wolle man trotz der genannten Bedenken am Begriff der Neutralität festhalten, lege das Grundgesetz ein pluralistisches Verständnis nahe. Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GG normiere, dass der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu | |
Unabhängig hiervon sei die Regelung unverhältnismäßig.
| |
Das Vorliegen eines legitimen Zwecks könne bezweifelt werden. Es erscheine fraglich, ob der nicht näher konkretisierte Verweis auf Rechts- und Verfassungsprinzipien wie die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates und die richterliche Unabhängigkeit ausreichten, um Grundrechtseingriffe mit hoher Eingriffsintensität im Einzelfall zu rechtfertigen. Den in § 45 Satz 2 HBG genannten Friedensvorstellungen oder auch dem im Ausgangsverfahren genannten "Verhandlungsfrieden" und dem Vertrauen in die religiöse Neutralität des Staates komme kein Verfassungsrang zu. § 45 Satz 2 HBG wäre allenfalls teleologisch zu reduzieren auf den verfassungskonformen Zweck, die Funktionsfähigkeit einer auch im Erscheinungsbild unabhängigen und unparteiischen Justiz im Sinne von Art. 97 GG zu sichern.
| |
Nach § 45 Satz 2 HBG sei Voraussetzung für das Kopftuchverbot, dass sich das Kopftuch "objektiv eigne", die Neutralität der Amtsführung -- hier der Wahrnehmung "praktischer Aufgaben" | |
Das Kopftuchverbot und der Ausschluss von "praktischen Aufgaben" im Vorbereitungsdienst seien nicht erforderlich. Die Ausgangsentscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main sei überzeugend davon ausgegangen, dass, soweit überhaupt nötig, Maßnahmen der Aufklärung und Information der mit der Gerichtspraxis nicht vertrauten Verfahrensbeteiligten oder der Hinweis auf die mögliche Ablehnung wegen Befangenheit effektiv "Abhilfe" schaffen könnten.
| |
Das Verbot sei zudem nicht angemessen. Zunächst sei zu beanstanden, dass der Hessische Verwaltungsgerichtshof eine von einem Kopftuch angeblich ausgehende abstrakte Gefahr ausreichen lasse, um Grundrechte gegenüber den Belangen der staatlichen Neutralität und der negativen Religionsfreiheit der Prozessbeteiligten einzuschränken. Daneben trügen die Einschränkungen und Verhaltens- sowie Bekleidungsgebote den rechtlichen und funktionalen Unterschieden zwischen einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis einerseits und einem Amtsverhältnis als Richterin oder als Beamtin andererseits nicht angemessen Rechnung. Sie berücksichtigten die unterschiedlichen Anforderungen an das dienstliche Verhalten und die Kleidung im Dienst nicht angemessen, die daraus resultierten, dass Rechtsreferendarinnen unter der | |
2. Das Kopftuchverbot im Referendardienst verletze sie auch in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG. Der schwerwiegende Eingriff in die Religionsfreiheit sei verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Der angegriffene Beschluss stelle das religiöse Bedeckungsgebot und -- gestützt auf § 45 Satz 2 HBG -- das Neutralitätsgebot für den Bereich der Justiz in die praktische Konkordanz ein. Für den schonenden Ausgleich von Religionsfreiheit einerseits und einem Neutralität und Frieden sichernden Kopftuchverbot andererseits habe das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass ein Verbot religiöser Bekundungen, das bereits bei der abstrakten Gefahr einer Beeinträchtigung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität greife, mit Blick auf die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit unangemessen und damit unverhältnismäßig sei, wenn die Bekundung auf ein als verpflichtend empfundenes religiöses Gebot zurückzuführen sei. Diese für Pädagoginnen getroffene Entscheidung sei auf Referendarinnen im juristischen Vorbereitungsdienst übertragbar.
| |
3. Der Beschluss greife in ihr Grundrecht auf Selbstbestimmung, Selbstbewahrung und Selbstdarstellung als Bedingungen der Identitätsbildung aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ein. Die Bedeckung werfe neben dem als verpflichtend empfundenen religiösen Gebot zugleich die Frage auf, wie sie sich als Frau im öffentlichen Raum und bei alltäglichen sozialen Kontakten ihrer Vorstellung von Würde entsprechend darstellen wolle. Neben die religiöse Verpflichtung trete die aus ihrem Selbstbild und ihrer Identitätsvorstellung abgeleitete Bekleidungsregel, sich nicht mit unbedecktem Haupthaar in der Öffentlichkeit zu zeigen. | |
IV.
| |
Zum Verfahren haben die Hessische Staatskanzlei, die Niedersächsische Landesregierung, die Bayerische Staatsregierung, der Humanistische Verband Deutschlands, der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, das Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland, die Evangelische Kirche in Deutschland, der Zentralrat der Muslime in Deutschland, der Zentralrat der Ex-Muslime, der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, die Neue Richtervereinigung, der Deutsche Richterbund sowie der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen Stellung genommen.
| |
1. Die Hessische Staatskanzlei hält die Verfassungsbeschwerde insoweit für unzulässig, als mit ihr beantragt werde, den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 und das darin ausgesprochene Verbot aufzuheben, als Rechtsreferendarin bei Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenwirkung im Rahmen ihres juristischen Vorbereitungsdienstes ein Kopftuch zu tragen. Dieser Antrag sei insoweit gegenstandslos und die Verfassungsbeschwerde unzulässig geworden, als das Hessische Ministerium der Justiz den genannten Erlass mit seinem Erlass vom 24. Juli 2017 aufgehoben habe.
| |
Soweit die Verfassungsbeschwerde zulässig sei, sei sie unbegründet. Zwar liege ein Eingriff in die Schutzbereiche der Religionsfreiheit aus Art. 4 GG und der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG vor, dieser sei aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
| |
Mit der Verpflichtung von Rechtsreferendarinnen zur religiösen | |
Der Gesetzgeber beschreibe auf der Tatbestandsseite des § 45 HBG einen Wirkungszusammenhang, den er für möglich halten und als neutralitätsschädlich unterbinden dürfe. Er sei danach berechtigt, seiner Regelung die Annahme zugrunde zu legen, Kleidungsstücke, Symbole und sonstige Merkmale könnten -- und sollten vielfach auch -- inhaltlich aussagekräftig sein und den Schluss auf die Überzeugung desjenigen zulassen, der sich ihrer in der Öffentlichkeit bediene. Des Weiteren habe der Gesetzgeber darauf abgestellt, die verwendeten Merkmale bräuchten nur objektiv geeignet zu sein, das Vertrauen in die Neutralität der Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Mit dieser Formulierung sei es ihm indessen nicht um eine Grenzbestimmung zwischen abstrakter und konkreter Vertrauensbeeinträchtigung und Friedensgefährdung gegangen, sondern allein um die Klarstellung, dass es für diese Wirkungen nicht auf die Absichten der Trägerin ankomme. Deshalb lasse sich das Gesetz dahin verstehen, dass zumindest dann, wenn die Glaubensbekundung nachvollziehbar auf ein als verpflichtend betrachtetes religiöses Gebot zurückzuführen sei, jene objektive Eignung eine konkrete Gefahr für den politischen, weltanschaulichen oder religiösen Frieden voraussetze oder aber das Vertrauen in die Neutralität der Amtsführung konkret beeinträchtige. Diese Einschränkung habe das Hessische Innenministerium übernommen. Auf diese Weise sei für den Bereich der allgemeinen Verwaltung und damit für die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltungsstation den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts genügt. | |
Das Verbot des Kopftuchs bei dienstlichen Kontakten mit Verfahrensbeteiligten erweise sich auch als angemessen und im engeren Sinne verhältnismäßig. Aus der Sicht und nach den Erfahrungen des Justizprüfungsamtes sei der Behauptung der Beschwerdeführerin, sie werde praktisch von einer sachgerechten und ihr Recht auf Ausbildung sichernden Teilnahme an den praktischen Aufgaben des Vorbereitungsdienstes ausgeschlossen, entschieden entgegenzutreten. Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 JAG solle die Rechtsreferendarin praktische Aufgaben in möglichst weitem | |
2. Die Niedersächsische Landesregierung ist der Auffassung, der vorliegende Grundrechtseingriff halte einer materiellen Überprüfung am Maßstab kollidierenden Verfassungsrechts stand. Gemeinschaftswerte von Verfassungsrang und gegebenenfalls auch die Grundrechte Dritter erforderten es, dass die Justiz den Bürgerinnen und Bürgern auch äußerlich neutral gegenübertrete. Das Grundgesetz gehe von dem Bild einer nur Recht und Gesetz unterworfenen und dabei den Verfahrensbeteiligten unvoreingenommen und neutral gegenübertretenden Richterpersönlichkeit aus. Die Überzeugungskraft richterlicher Entscheidungen beruhe vor diesem Hintergrund nicht nur auf der juristischen Qualität ihrer Gründe; sie stütze sich in hohem Maße auch auf das Vertrauen, das den Richterinnen und Richtern von der Bevölkerung entgegengebracht werde. Dieses Vertrauen fuße nicht zuletzt auf der äußeren und inneren Unabhängigkeit des Richters, seiner Neutralität und erkennbaren Distanz. Eine Kundgabe religiöser Überzeugungen, die geeignet sei, dieses Vertrauen zu erschüttern, widerspreche dem Richterbild des Grundgesetzes. Auch Referendarinnen und Referendare müssten Neutralität und Distanz an | |
Das Neutralitätsverlangen des Grundgesetzes sei nicht situationsbezogen, sondern umfassend zu verstehen. Nur ein generelles und vom Einzelfall unabhängiges Verbot könne einem möglichen Vertrauensverlust vorbeugen und den Eindruck verhindern, die Rechtsprechungstätigkeit könne womöglich auch durch sachfremde -- religiöse -- Einflüsse geprägt werden. Ein anlass- beziehungsweise konfliktbezogenes Verbot werde dieses Ziel -- anders als nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Fall des Kopftuchs bei Lehrkräften -- verfehlen, weil der Vertrauensverlust unwiderruflich eingetreten sein würde, bevor ein Verbot ausgesprochen werden könnte. Zudem werde ein Unbehagen der Verfahrensbeteiligten in Anbetracht religiöser Symbole nicht stets offen zutage treten. Auch in derartigen Fällen gerate das Vertrauen in die Justiz indes in Gefahr.
| |
3. Die Bayerische Staatsregierung hält die Verfassungsbeschwerde für unbegründet.
| |
Der Eingriff in die Grundrechte der Beschwerdeführerin sei von lediglich geringer Intensität. Die ihr aufgrund ihres Kopftuchs verwehrten Tätigkeiten stellten lediglich einen sehr eng begrenzten Ausschnitt des Rechtsreferendariats dar. Außerdem habe sie keine negativen Auswirkungen auf ihre Gesamtnote zu befürchten.
| |
Das Verbot bezwecke den Schutz wichtiger Belange, denen das Grundgesetz Verfassungsrang beimesse und die aufgrund ihrer hohen Bedeutung selbst einen deutlich intensiveren Eingriff in die Rechtspositionen der Beschwerdeführerin rechtfertigen würden. Zunächst diene es der verfassungsrechtlich gebotenen Wahrung des Vertrauens der rechtsunterworfenen Bürger in die unbedingte und uneingeschränkte Neutralität des Staates sowie der diesen repräsentierenden Amtsträger im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens. Daneben sei auch die negative Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der (übrigen) Prozessbeteiligten betroffen. Eine Differenzierung zwischen Richterinnen und Rechtsreferendarinnen sei insoweit nicht geboten. | |
4. Nach Auffassung des Humanistischen Verbands Deutschlands kann eine Referendarin im juristischen Vorbereitungsdienst keine religiöse Bekleidung und kein religiöses Symbol tragen, sofern sie zu Ausbildungszwecken einen Richter oder Staatsanwalt vertritt. Anders sehe der Fall aus, in dem die Referendarin ohne Robe auf der Richterbank sitze, wenn sie zu Ausbildungszwecken an der Verhandlung teilnehme. Hier könne durch ein Schild klargestellt werden, dass es sich nicht um ein Mitglied des Gerichts handele, welches entscheidungsbefugt sei. Auch eine räumliche | |
5. Aus der Sicht des Dachverbandes Freier Weltanschauungsgemeinschaften erscheint § 45 Satz 3 HBG als nicht mit Art. 3 GG vereinbar, soweit als Prüfungsmaßstab für die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 auf die christlich und humanistisch geprägte abendländische Tradition des Landes Hessen Bezug genommen wird. Dieser Satz erscheine im Hinblick auf die Trennung von Staat und Kirche sowie auf die Religions- und Bekenntnisfreiheit des Einzelnen weder in Bezug auf die konkrete Entscheidung noch im Hinblick auf andere Sachverhalte geeignet, zu einer verfassungsgemäßen Bewertung der gebotenen religiösen und weltanschaulichen Neutralität von Beamten zu gelangen. Es sei besonders wichtig, die Trennung von Staat und Kirche einzuhalten, was für im Staatsdienst tätige Personen bedeute, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit bekenntnis- und weltanschauungsneutral handeln müssten. Die Anforderungen seien auch an eine Referendarin im juristischen Vorbereitungsdienst zu stellen.
| |
6. Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten sieht es als problematisch an, dass nach § 45 Satz 3 HBG der christlich und humanistisch geprägten abendländischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu tragen ist. Es sei geklärt, dass Ausnahmeregelungen zugunsten der Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte verfassungswidrig seien.
| |
Soweit in dem Kopftuchverbot ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit aus Art. 12 GG gesehen werden könne, sei dieser durch die von den Fachgerichten herangezogenen Vorschriften gedeckt. Das Recht auf freie Religionsausübung sei ebenfalls nicht verletzt. Es habe hinter der negativen Religionsfreiheit anderer Beteiligter an gerichtlichen oder behördlichen Verfahren und dem staatlichen Neutralitätsgebot zurückzustehen. Der Verfahrensbe | |
7. Das Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland hält das hier in Rede stehende Kopftuchverbot für verfassungswidrig.
| |
Bei der materiellen verfassungsrechtlichen Beurteilung sei allgemein zu berücksichtigen, dass sich die Stellung der Rechtsreferendarinnen von derjenigen der Richterinnen und Staatsanwältinnen unterscheide. Erstere würden nur unter Aufsicht für die in § 10 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) abschließend aufgezählten richterlichen Tätigkeiten eingesetzt. Sie befänden sich zudem in einer Ausbildungssituation, die für die Zweite Juristische Staatsprüfung verpflichtende Voraussetzung und damit auch für Berufe außerhalb des Staatsdienstes unabdingbar sei.
| |
Für muslimische Referendarinnen mit Kopftuch stellten Kopftuchverbote nicht nur eine Verletzung ihrer Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG, sondern zugleich eine gleichheitswidrige Behandlung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Religion (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 3 GG) dar. Kopftuchverbote knüpften an eine Vielzahl von Diskriminierungsmerkmalen an, ohne dass eines alleine ausschlaggebend wäre. Es werde ausschließlich der erkennbaren Muslimin die umfassende und gleichberechtigte Juristenausbildung im Referendariat verwehrt. Für eine ganz bestimmte, strukturell benachteiligte Minderheit (kopftuchtragende muslimische Frauen) werde eine Juristenausbildung zweiter Klasse geschaffen.
| |
Eine Rechtfertigung aufgrund der negativen Religionsfreiheit der Prozessbeteiligten komme nicht in Betracht. Eine Parallele zur Kruzifix-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kön | |
Jeweils für sich stehe weder die Unabhängigkeit des Richters aus Art. 97 Abs. 1 GG noch die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates dem Tragen eines Kopftuchs durch eine Rechtsreferendarin entgegen. Art. 97 Abs. 1 GG gelte bereits nur für die Richterperson, könne also nicht entgegen seinem eindeutigen Wortlaut auf Referendarinnen ausgedehnt werden. Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates sei ein an den Staat gerichtetes objektives Verfassungsprinzip, das dem Staatsbediensteten erst entgegengehalten werden könne, wenn er seine Stellung zur gezielten Beeinflussung missbrauche.
| |
8. Die Evangelische Kirche in Deutschland führt aus, dem Vertrauen in die Neutralität und Unparteilichkeit der Justiz sei ein hoher Stellenwert beizumessen. Dem dienten unter anderem die Regelungen zu einer einheitlichen Amtstracht der handelnden Personen. Durch die Amtstracht werde anschaulich, dass jemand eine bestimmte Rolle wahrnehme und von dieser vereinnahmt werde. Sie markiere zugleich die Differenz zwischen der Person und dem Amt und schaffe eine gewisse Distanz zum Interaktionspartner, dem der Amtsträger nicht bloß "von Mensch zu Mensch", sondern als Repräsentant des Staates begegne. Diese Funktion werde relativiert oder gar konterkariert, wenn zur Amtstracht auffällige weitere Kleidungsstücke oder Symbole träten, die eine gegenläufige Botschaft vermittelten. Dies sei zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, bedürfe aber einer besonderen Abwägung. Bei Entscheidungen darüber, ob Staatsbedienstete religiös akzentuierte Kleidung bei der Amtsführung tragen dürften, sei die polyvalente Wirkung von Symbolen zu bedenken. Antworten ließen sich nicht einfach aus Verfassungsprinzipien deduzieren. Viel | |
9. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hält die Verfassungsbeschwerde für begründet. Für den vorliegenden Grundrechtseingriff bestehe kein legitimes Ziel. Das Kopftuchverbot diene nicht dem Schutz der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates, sondern allein des faktisch konstruierten "Vertrauens" in diese. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auf die Wahrung eines objektiv-rechtlichen Verfassungsprinzips (Neutralität) sei aber kein verfassungsrechtlich geschütztes Rechtsgut. Obendrein berücksichtige der vorliegende Fall nur die antizipierte vorurteilsbeladene Sicht Dritter hinsichtlich der Staatstreue und Vertrauenswürdigkeit muslimischer Staatsbediensteter und missachte die möglichen positiven Effekte der Sichtbarkeit ethnischer, religiöser oder gesellschaftlicher Minderheiten auf der Richterbank.
| |
Der pauschale Ausschluss von der Wahrnehmung staatsanwaltschaftlicher, richterlicher und bestimmter Verwaltungstätigkeiten stehe in keinem Verhältnis zu den dadurch bewirkten Nachteilen. Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 JAG sollten die praktischen Arbeiten in der Juristenausbildung die Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit der Rechtsreferendare stärken, indem diese maßgeblich an der Wahrnehmung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenwirkung mitwirkten. Der Betroffenen hingegen würden diese grundlegenden Lernerfahrungen, in denen sie gerade die intendierten Kompetenzen Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit für ihre berufliche Zukunft erlernen könne, verwehrt. Eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Referendaren sei nicht begründbar.
| |
Der vom Land Hessen lediglich vermutete Eingriff in Freiheitsrechte Dritter sei allenfalls von marginaler Intensität. Wenn das Bundesverfassungsgericht selbst schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen zumute, zwischen der muslimischen Lehrerin mit Kopftuch und dem Staat zu unterscheiden, sei nicht ersichtlich, weshalb dies nicht für erwachsene, meistens auch anwaltlich ver | |
Eine Neutralitätspflicht könne vorliegend auch nicht aus den Art. 97, 101 Abs. 1 Satz 2 GG hergeleitet werden, da diese Normen für Rechtsreferendarinnen nicht gelten. Für den staatsanwaltschaftlichen Bereich oder die Verwaltung könnten die Vorschriften generell nicht herangezogen werden. Unabhängig hiervon bestehe die Gefahr, dass außerrechtliche wie beispielsweise religiöse Kriterien bei der Entscheidungsfindung Geltung fänden, bei jedem gläubigen Richter, unabhängig davon, ob äußerlich sichtbare religiöse Merkmale vorhanden seien oder nicht. Das subjektive Empfinden einzelner Verfahrensbeteiligter zuungunsten individueller Freiheitsrechte durchzusetzen, um einen mutmaßlichen Eindruck der Objektivität herzustellen, sei verfassungsrechtlich nicht haltbar. Die Religionszugehörigkeit allein stelle noch keinen Befangenheitsgrund dar. Es sei diskriminierend, gerade bei muslimischen Frauen von ihrem Bekenntnis auf ihre fehlende Gesetzestreue schließen zu wollen.
| |
10. Der Zentralrat der Ex-Muslime argumentiert im Ergebnis damit, dass das Tragen eines Kopftuchs ein Menschenbild vermittele, das mit dem Grundgesetz und den universellen Menschenrechten nicht kompatibel sei. Wenn Musliminnen ein glaubensgeleitetes Leben auf der Grundlage von Koran und Sunna führen wollten und dies beispielsweise durch eine strikte Befolgung des Bedeckungsgebots auch während der Dienstzeit demonstrierten, bestünden berechtigte Zweifel an der Loyalität zum säkularen, freiheitlich demokratischen Rechtsstaat und seiner Werteordnung.
| |
11. Nach Auffassung des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland ist die Verfassungsbeschwerde begründet.
| |
Der in dem Kopftuchverbot liegende Grundrechtseingriff wie | |
Die teilweise vertretene Ansicht, in der Justiz habe ein besonders strenger Neutralitätsbegriff zu gelten, könne nicht überzeugen. Die richterliche Unabhängigkeit nach Art. 97 Abs. 1 GG sowie das Recht auf den gesetzlichen Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG seien von der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates zu unterscheiden. Außerdem seien diese Vorschriften weder auf Rechtsreferendarinnen noch auf Staatsanwältinnen oder Verwaltungsbeamtinnen anwendbar. Allgemein hindere das religiös motivierte Tragen eines Kleidungsstücks allein die Richterin nicht daran, frei von außerrechtlichen Einflüssen, Zwängen und Rücksichtnahmen Gesetz und Recht Geltung zu verschaffen. Anders sei dies nur, wenn sie aufgrund weiterer Umstände einen gegenteiligen Eindruck hervorrufe. Diesen Fällen könne aber durch die Befangenheitsregelungen begegnet werden.
| |
Eine Rechtfertigung durch die negative Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten komme ebenfalls nicht in Betracht. Diese enthalte kein Verfügungsrecht über die positive Religionsfreiheit der Richterin. Auch bestehe keine Vergleichbarkeit zu der vom Bundesverfassungsgericht in seiner "Kruzifix-Rechtsprechung" angenommenen unausweichlichen Zwangslage. Vielmehr nehme der Staat hier die Ausübung der Religionsfreiheit der Rechtsreferendarin lediglich hin. Damit würden die Verfahrensbeteiligten nur mit der ausgeübten positiven Glaubensfreiheit der Rechtsreferendarin in Form einer religiös motivierten Bekleidung konfrontiert, was im Übrigen durch das Auftreten anderer Repräsentanten des Gerichts mit anderem Glauben oder anderer Weltanschauung in aller Regel relativiert und ausgeglichen werde.
| |
12. Nach Auffassung der Neuen Richtervereinigung ist die Ver | |
Soweit der Hessische Verwaltungsgerichtshof in der angegriffenen Entscheidung die Situation in der Schule von der in der Justiz abgrenzen wolle, könne dem nicht uneingeschränkt gefolgt werden. Die staatliche Neutralitätspflicht sei sowohl in der Schule als auch im Gericht durch Lehrerinnen beziehungsweise Referendarinnen mit Kopftuch zunächst einmal nur abstrakt gefährdet. Weshalb aber nur im Bereich der Justiz bereits die abstrakte Gefahr für ein Kopftuchverbot ausreichen solle, erschließe sich nicht. Die fehlende Möglichkeit im Gerichtssaal, die innere Einstellung der Richterin oder Staatsanwältin durch kritische Diskussion zu eru | |
13. Der Deutsche Richterbund hält die Verfassungsbeschwerde für unbegründet. Zwar gebe es keinen allgemeinen Erfahrungssatz, nach dem aus dem Tragen bestimmter Kleidungsstücke (z.B. eines islamischen Kopftuchs) ohne Weiteres auf eine Haltung des Richters geschlossen werden könne, bei der Entscheidung von Streitsachen in Zweifels- oder Konfliktfällen religiösen Regeln oder Vorstellungen den Vorrang vor staatlichen Gesetzen zu geben. Das Verbot, als Repräsentant der dritten Staatsgewalt religiöse Kleidungsstücke oder Zeichen sichtbar zu tragen, diene aber auch nicht der Abwehr einer konkreten oder abstrakten Gefahr für die Gesetzesbindung der Justiz oder einem "Verhandlungsfrieden". Ein Gerichtsverfahren habe vielmehr die Aufgabe, Rechtsstreitigkeiten zwischen den Prozessparteien frei von externen Einflüssen auf einem strikt neutralen Forum einer Lösung zuzuführen. In einem rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen sei es zentrale Aufgabe des unabhängigen gesetzlichen Richters, hierfür einen neutralen Raum zu gewährleisten. Jedwede nicht mit dem Verfahren an sich zusammenhängende Ablenkung schmälere diesen neutralen Raum. Im Hinblick auf den hohen Stellenwert eines neutralen und unvoreingenommenen Richters für das Rechtsstaatsprinzip und die eher moderate Beschränkung der Religionsfreiheit und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit seien die strittigen Regelungen in § 45 HBG verhältnismäßig.
| |
14. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungs | |
Die positive Religionsfreiheit der Beschwerdeführerin müsse gegenüber der negativen Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten und der staatlichen Pflicht zur weltanschaulich-religiösen Neutralität zurücktreten. Es sei mit dem Gebot praktischer Konkordanz nicht vereinbar, die staatliche Neutralität und Empfindungen andersdenkender Verfahrensbeteiligter völlig zurückzudrängen, damit -- hier -- die Rechtsreferendarin ihre Glaubens- und Bekenntnisfreiheit uneingeschränkt nach außen kundtun könne. Es sei einem Verfahrensbeteiligten nicht zuzumuten, unter der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit einer Repräsentantin des Staates einem staatlichen Verfahren ausgesetzt zu sein, dem er sich nicht entziehen könne.
| |
15. Dem Senat haben die Akten des Ausgangsverfahrens vorgelegen. Den zugleich mit der Verfassungsbeschwerde von der Beschwerdeführerin gestellten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat die 1. Kammer des Zweiten Senats durch Beschluss vom 27. Juni 2017 aufgrund einer Folgenabwägung abgelehnt. | |
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, soweit sie sich mittelbar gegen den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Juni 2007 wendet. Gerichte sind an verwaltungsinterne Weisungen nicht gebunden, sondern haben selbständig über ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und mit dem einfachen Gesetz zu urteilen (vgl. BVerfGE 12, 180 [199]; 78, 214 [227]). Der Erlass ist daher kein Gesetz im Sinne des § 95 Abs. 3 Satz 2 BVerfGG, auf dem der unmittelbar angegriffene Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs beruhen und das nur das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklären könnte.
| |
Im Übrigen ist die Verfassungsbeschwerde zulässig. Insbesondere besteht das Rechtsschutzbedürfnis der Beschwerdeführerin auch nach Abschluss der praxisbezogenen Abschnitte des Rechtsreferendariats, in denen die streitgegenständliche Anordnung Wirkung entfaltete, fort. Ein Rechtsschutzbedürfnis ist insbesondere dann gegeben, wenn die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung andernfalls unterbleibt und der gerügte Grundrechtseingriff besonders belastend erscheint (vgl. BVerfGE 81, 138 [140]; 99, 129 [138]; 119, 309 [317]; 139, 148 [171 Rn. 44]). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die direkte Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt -- wie hier -- auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der Betroffene nach dem regelmäßigen Geschäftsgang eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kaum erlangen konnte (vgl. BVerfGE 81, 138 [140f.]; 107, 299 [311]; 110, 77 [85f.]; 117, 244 [268]; 146, 294 [308ff. Rn. 24]; 149, 293 [316 Rn. 59]; stRspr). Der Grundrechtsschutz des Betroffenen würde andernfalls in unzumutbarer Weise verkürzt (vgl. BVerfGE 34, 165 [180]; 41, 29 [43]; 49, 24 [51f.]; 81, 138 [141]; 149, 293 [316 Rn. 59]).
| |
Soweit die Verfassungsbeschwerde sich unmittelbar gegen den Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 23. Mai 2017 und mittelbar gegen das Neutralitätsgebot im Hessischen Beamtengesetz wendet, ist sie unbegründet. Der angegriffene Be | |
I.
| |
1. Die der Beschwerdeführerin auferlegte und vom Verwaltungsgerichtshof bestätigte Pflicht, bei Tätigkeiten, bei denen sie als Repräsentantin des Staates wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden könnte, die eigene Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft nicht durch das Befolgen von religiös begründeten Bekleidungsregeln sichtbar werden zu lassen, greift in die von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verbürgte individuelle Glaubensfreiheit ein. Sie stellt die Beschwerdeführerin vor die Wahl, entweder die angestrebte Tätigkeit auszuüben oder dem von ihr als verpflichtend angesehenen religiösen Bekleidungsgebot Folge zu leisten.
| |
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG enthält ein umfassend zu verstehendes einheitliches Grundrecht (vgl. BVerfGE 24, 236 [245f.]; 32, 98 [106]; 44, 37 [49]; 83, 341 [354]; 108, 282 [297]; 125, 39 [79]; stRspr). Es erstreckt sich nicht nur auf die innere Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, das heißt einen Glauben zu haben, zu verschweigen, sich vom bisherigen Glauben loszusagen und einem anderen Glauben zuzuwenden, sondern auch auf die äußere Freiheit, den Glauben zu bekunden und zu verbreiten, für seinen Glauben zu werben und andere von ihrem Glauben abzuwerben (vgl. BVerfGE 12, 1 [4]; 24, 236 [245]; 105, 279 [294]; 123, 148 [177]). Umfasst sind damit nicht allein kultische Handlungen und die Ausübung und Beachtung religiöser Gebräuche, sondern auch die religiöse Erziehung sowie andere Äußerungsformen des religiösen und weltanschaulichen Lebens (vgl. BVerfGE 24, 236 [245f.]; 93, 1 [17]). Dazu gehört das Recht der Einzelnen, ihr ge | |
Die Beschwerdeführerin kann sich auch als in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehende Rechtsreferendarin auf ihr Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG berufen. Ihre Grundrechtsberechtigung wird durch die Eingliederung in den staatlichen Aufgabenbereich nicht von vornherein oder grundsätzlich in Frage gestellt (vgl. für Beamte BVerfGE 108, 282 [297f.] sowie für Angestellte im öffentlichen Dienst BVerfGE 138, 296 [328 Rn. 84]; vgl. auch BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 18. Oktober 2016 -- 1 BvR 354/11 --, Rn. 58).
| |
Bei der Würdigung dessen, was im Einzelfall als Ausübung von Religion und Weltanschauung zu betrachten ist, darf das Selbstverständnis der jeweils betroffenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und des einzelnen Grundrechtsträgers nicht außer Betracht bleiben (vgl. BVerfGE 24, 236 [247f.]; 108, 282 [298f.]; 138, 296 [329 Rn. 86]). Musliminnen, die ein in der für ihren Glauben typischen Weise gebundenes Kopftuch tragen, können sich dafür auch im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes auf den Schutz der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG berufen. Darauf, dass im Islam unterschiedliche Auffassungen zum sogenannten Bedeckungsgebot vertreten werden (vgl. etwa Wielandt, Die Vorschrift des Kopftuchtragens für die muslimische Frau: Grundlagen und aktueller innerislamischer Diskussionsstand, 2009, abrufbar unter http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/Wielandt_Kopftuch.pdf [abgerufen am 14. Januar 2020]; ahin, Die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs, 2014, S. 123ff.; Steinberg, Zwischen Grundgesetz und Scharia, 2018, S. 96--98 m.w.N.), kommt es insoweit nicht an, da die religiöse Fundierung der Bekleidungswahl nach geistigem Gehalt und äußerer Erscheinung jedenfalls hinreichend plausibel ist (vgl. BVerfGE 108, 282 [298f.]; 138, 296 [330 Rn. 87ff.]; BVerfG, | |
2. Der Eingriff in die Religionsfreiheit ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
| |
Einschränkungen von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG müssen sich aus der Verfassung selbst ergeben, weil dieses Grundrecht keinen Gesetzesvorbehalt enthält. Zu solchen verfassungsimmanenten Schranken zählen die Grundrechte Dritter sowie Gemeinschaftswerte von Verfassungsrang (vgl. BVerfGE 28, 243 [260f.]; 41, 29 [50f.]; 41, 88 [107]; 44, 37 [49f., 53]; 52, 223 [247]; 93, 1 [21]; 108, 282 [297]; 138, 296 [333 Rn. 98]; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 18. Oktober 2016 -- 1 BvR 354/11 --, Rn. 61). Die Einschränkung bedarf überdies einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage (vgl. BVerfGE 108, 282 [297]).
| |
a) Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dass der für die Auslegung des einfachen Rechts zunächst zuständige Verwaltungsgerichtshof (vgl. BVerfGE 138, 296 [331 Rn. 91]) § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 Sätze 1 und 2 HBG formell als die Religionsfreiheit einschränkende Gesetzesnorm herangezogen hat.
| |
Soweit der Verwaltungsgerichtshof annimmt, es sei zulässig, in § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG eine Bezugnahme auch auf den zeitlich erst nach Erlass dieser Verweisungsnorm in das Gesetz eingefügten § 45 HBG zu sehen, entspricht die Begründung den Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht an die Zulässigkeit derartiger dynamischer Verweisungen anlegt (vgl. BVerfGE 26, 338 [365]; 47, 285 [312]; 141, 143 [176f. Rn. 75]; siehe ferner statt vieler nur Dreier, in: Dreier, GG, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 20 Rn. 118 m.w.N.).
| |
Der Verwaltungsgerichtshof ist zudem in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, dass die von ihm herangezogene gesetzliche Grundlage hinreichend bestimmt ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fehlt die notwendige Bestimmtheit nicht schon deshalb, weil eine Norm auslegungsbedürftig ist (vgl. BVerfGE 45, 400 [420]; 117, 71 | |
b) Als mit der Glaubensfreiheit in Widerstreit tretende Verfassungsgüter, die einen Eingriff in die Religionsfreiheit im vorliegenden Zusammenhang rechtfertigen können, kommen der Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität (aa), der Grundsatz der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (bb) und mögliche Kollisionen mit der grundrechtlich geschützten negativen Religionsfreiheit Dritter in Betracht (cc). Keine rechtfertigende Kraft entfalten dagegen das Gebot richterlicher Unparteilichkeit (dd) und der Gedanke der Sicherung des weltanschaulich-religiösen Friedens (ee).
| |
aa) Das Grundgesetz begründet für den Staat als Heimstatt aller Staatsbürger in Art. 4 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3 Satz 1, Art. 33 Abs. 3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG die Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutralität. Es verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse ebenso wie die Ausgrenzung Andersgläubiger (vgl. BVerfGE 19, 206 [216]; 24, 236 [246]; 33, 23 [28]; | |
Die dem Staat gebotene weltanschaulich-religiöse Neutralität ist indessen nicht als eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen, sondern als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gebietet auch im positiven Sinn, den Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern (vgl. BVerfGE 41, 29 [49]; 93, 1 [16]). Der Staat darf lediglich keine gezielte Beeinflussung im Dienste einer bestimmten politischen, ideologischen oder weltanschaulichen Richtung betreiben oder sich durch von ihm ausgehende oder ihm zuzurechnende Maßnahmen ausdrücklich oder konkludent mit einem bestimmten Glauben oder einer bestimmten Weltanschauung identifizieren und dadurch den religiösen Frieden in einer Gesellschaft von sich aus gefährden (vgl. BVerfGE 93, 1 [16f.]; 108, 282 [300]; 138, 296 [339 Rn. 110]). Auch verwehrt es der Grundsatz weltanschaulich-religiöser Neutralität dem Staat, Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft als solche zu bewerten (vgl. BVerfGE 33, 23 [29]; 108, 282 [300]; 137, 273 [305 Rn. 88]; 138, 296 [339 Rn. 110]).
| |
Die Verpflichtung des Staates auf Neutralität kann keine andere sein als die Verpflichtung seiner Amtsträger auf Neutralität | |
Nimmt der Staat etwa auf das äußere Gepräge einer Amtshandlung besonderen Einfluss, so sind ihm abweichende Verhaltensweisen einzelner Amtsträger eher zurechenbar (vgl. Oebbecke, in: Germann/Muckel, Handbuch des Staatskirchenrechts, 3. Aufl., i.E., § 41 Rn. 25; zur Selbstdarstellung des Staates in diesem Zusammenhang ferner Ekkertz-Höfer, DVBl 2018, S. 537 [544f.]; Häberle, DVBl 2018, S. 1263 [1266]). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Um das Vertrauen in die Neutralität und Unparteilichkeit der Gerichte zu stärken, haben Bund und Länder nicht nur das Verfahren während der mündlichen Verhandlung in den jeweiligen Prozessordnungen detailliert geregelt. Zum Selbstbildnis des Staates gehören auch die Verpflichtung der Richterinnen | |
bb) Als weitere verfassungsimmanente Schranke der Religions | |
Bei der Auswahl der zu ergreifenden Optimierungsmaßnahmen hat der Staat einen Einschätzungsspielraum. Insbesondere bei der Verfolgung des Ziels, die Akzeptanz der Justiz in der Bevölkerung zu stärken, hat er aber darauf zu achten, dass die von ihm ausgemachten Akzeptanzdefizite auf objektiv nachvollziehbaren Umständen beruhen. Die Aufgabe, Recht zu sprechen und dabei auch die Werte durchzusetzen, auf denen das Grundgesetz gründet, bringt es mit sich, dass die Institution Justiz und deren Entscheidungen mitunter auf Widerstand in Teilen der Gesellschaft treffen. Dieser ist auszuhalten. Demgegenüber darf der Staat Maßnahmen ergreifen, die die Neutralität der Justiz aus der Sichtweise eines objektiven Dritten unterstreichen sollen. Das Verbot religiöser Bekundungen oder der Verwendung religiöser | |
cc) Für die Rechtfertigung eines Kopftuchverbots streitet im vorliegenden Zusammenhang auch die negative Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten.
| |
Dem durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gewährleisteten Recht zur Teilnahme an den kultischen Handlungen, die ein Glaube vorschreibt oder in denen er Ausdruck findet, entspricht umgekehrt die Freiheit, kultischen Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben. Diese Freiheit bezieht sich ebenfalls auf die Symbole, in denen ein Glaube oder eine Religion sich darstellt. Art. 4 Abs. 1 GG überlässt es dem Einzelnen, zu entscheiden, welche religiösen Symbole er anerkennt und verehrt und welche er ablehnt. Zwar hat er in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt, kein Recht darauf, von fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Davon zu unterscheiden ist aber eine vom Staat geschaffene Lage, in der der Einzelne ohne Ausweichmöglichkeiten dem Einfluss eines bestimmten Glaubens, den Handlungen, in denen dieser sich manifestiert, und den Symbolen, in denen er sich darstellt, ausgesetzt ist (BVerfGE 93, 1 [15f.]; 108, 282 [301f.]; 138, 296 [336 Rn. 104]; BVerfG, Be | |
Der Gerichtssaal stellt einen solchen Raum dar, in dem der Anblick religiöser Symbole im vorgenannten Sinne unausweichlich sein kann, wenn der Staat ihre Verwendung nicht untersagt. Hiermit kann für einzelne Verfahrensbeteiligte eine Belastung einhergehen, die einer grundrechtlich relevanten Beeinträchtigung gleichkommt (vgl. auch BayVerfGH, Entscheidung vom 14. März 2019 -- Vf. 3-VII-18 --, juris, Rn. 27f.). Anders als im Bereich der bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule, in der sich gerade die religiös-pluralistische Gesellschaft widerspiegeln soll (vgl. BVerfGE 138, 296 [337 Rn. 105]), tritt der Staat dem Bürger in der Justiz klassisch-hoheitlich und daher mit größerer Beeinträchtigungswirkung gegenüber (vgl. Steinberg, Der Staat 56 [2017], S. 157 [174]; Wolf, RuP 2017, S. 66; Häberle, Der Staat 57 [2018], S. 35 [56]; a.A. Muckel, NVwZ 2017, S. 1132 [1133]; Samour, djbZ 2018, S. 12 [13]; Sinder, Der Staat 57 [2018], S. 459 [465]). Das gilt auch, wenn die Verwendung des religiösen Symbols -- wie im Fall des Kopftuchs -- auf der privaten Entscheidung des für den Staat handelnden Amtsträgers beruht. Nur der Staat besitzt die Möglichkeit, die ansonsten unausweichliche Konfrontation mit dem Kopftuch als religiösem Symbol im Gerichtssaal zu verhindern (vgl. Röhrig, Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017, S. 205ff. unter Hinweis auf die staatliche Schutzpflicht).
| |
dd) Aus Art. 20 Abs. 2 Satz 2 und Art. 20 Abs. 3 GG sowie aus den die Justiz betreffenden Vorgaben der Art. 92, Art. 97 und Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG folgt unter anderem die Garantie der richterlichen Unparteilichkeit. Der Grundsatz, dass niemand in eigener Sache Richter sein darf, ist ein tragendes rechtsstaatliches Prinzip. Es gehört zum Wesen der richterlichen Tätigkeit, dass sie von einem nichtbeteiligten Dritten ausgeübt wird; dies erfordert Neutralität und Distanz gegenüber allen Verfahrensbeteiligten. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistet, dass der Einzelne im konkreten Fall vor einem Richter steht, der diese Voraussetzungen erfüllt (vgl. BVerfGE 3, 377 [381]; 4, 331 [346]; 14, 56 [69]; | |
Dieser Maßstab stimmt mit Art. 6 Abs. 1 EMRK und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte überein (vgl. BVerfGE 148, 69 [97 Rn. 71]). Unparteilichkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 1 EMRK bedeutet die Abwesenheit von Vorurteil und Parteinahme. Dies muss zum einen unter einem subjektiven Blickwinkel geprüft werden, wobei die persönliche Überzeugung und das Verhalten des Richters zu würdigen sind. Zum anderen sind objektive Gesichtspunkte zu prüfen. Es ist danach zu fragen, ob strukturelle oder funktionale Gründe der Unparteilichkeit entgegenstehen. Maßgeblich ist, ob das Gericht insbesondere durch seine Zusammensetzung ausreichende Gewähr dafür bietet, jeden legitimen Zweifel an seiner Unparteilichkeit auszuschließen (BVerfGE 148, 69 [98f. Rn. 74]; vgl. EGMR, Fey v. Austria, Urteil vom 24. Februar 1993, Nr. 14396/88, Rn. 27ff.; Pullar v. The United Kingdom, Urteil vom 10. Juni 1996, Nr. 22399/93, Rn. 30; Morel v. France, Urteil vom 6. Juni 2000, Nr. 34130/96, Rn. 40ff.; Wettstein v. Switzerland, Urteil vom 21. Dezember 2000, Nr. 33958/96, Rn. 42; EGMR [GK], Micallef v. Malta, Urteil vom 15. Oktober 2009, Nr. 17056/06, Rn. 93; EGMR, Oleksandr Volkov v. Ukraine, Urteil vom 9. Januar 2013, Nr. 21722/11, Rn. 104).
| |
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, Verfahrensregelungen vorzusehen, die es ermöglichen, im Einzelfall die Neutralität und Distanz der zur Entscheidung berufenen Richter zu sichern (vgl. BVerfGE 21, 139 [146]; 30, 149 [153]; 148, 69 [97 Rn. 70]). Diesem Ziel dienen die prozessrechtlichen Vorschriften über die Ausschließung von Richtern und ihre Ablehnung wegen einer begrün | |
Das Verwenden eines religiösen Symbols im richterlichen Dienst ist für sich genommen indes nicht geeignet, Zweifel an der Objektivität der betreffenden Richter zu begründen (vgl. Wißmann, DRiZ 2016, S. 224 [226]; Rath, RuP 2017, S. 67; Payandeh, DÖV 2018, S. 482 [486]; Sacksofsky, djbZ 2018, S. 8 [9]; Sinder, Der Staat 57 [2018], S. 459 [469]). Ebenso wenig, wie die Zugehörigkeit eines Richters zu einer politischen Partei für sich allein die Besorgnis der Befangenheit begründen kann (vgl. BVerfGE 2, 295 [297]; 11, 1 [3]; 43, 126 [128]), ist dies bei seiner Religions- oder Konfessionszugehörigkeit der Fall (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 3. Juli 2013 -- 1 BvR 782/12 --, Rn. 6). Von im Auswahlverfahren für das Richteramt erfolgreichen Juristen kann unabhängig von ihrer weltanschaulichen, religiösen oder politischen Einstellung Rechtstreue erwartet werden (vgl. Wiese, Lehrerinnen mit Kopftuch, 2008, S. 306; Berghahn, KJ 2018, S. 167 [176]; Eckertz-Höfer, DVBl 2018, S. 537 [541]). Sie haben in der Regel in diesem Auswahlverfahren und in der zuvor absolvierten Ausbildung unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, einen Rechtsfall unparteilich zu behandeln. Es besteht kein Grund, diese Fähigkeit denjenigen Personen abzusprechen, die ihre religiöse Einstellung durch die Verwendung von Symbolen offen für Dritte erkennbar werden lassen. Sollten Ein | |
ee) Nach dem Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität ist es dem Staat zwar untersagt, den religiösen Frieden in einer Gesellschaft von sich aus durch die gezielte Beeinflussung im Dienste einer bestimmten weltanschaulichen Richtung oder durch die Identifizierung mit einem bestimmten Glauben oder einer bestimmten Weltanschauung zu gefährden (vgl. BVerfGE 93, 1 [16f.]; 108, 282 [300]; 138, 296 [339 Rn. 110]). Ein von staatlichen Handlungen unabhängiger, allgemeiner Schutzanspruch für den gesellschaftlich-religiösen Frieden im Sinne einer alle Lebensbereiche umfassenden Garantenpflicht lässt sich aus dieser Neutralitätspflicht allerdings nicht ableiten (vgl. Sacksofsky, DVBl 2015, S. 801 [806]). Auch die übrigen Bestimmungen des Grundgesetzes enthalten keine derart weitreichende Verpflichtung. Eine solche Schutzpflicht des Staates gegenüber Störungen des weltanschaulichen-religiösen Friedens durch Dritte kommt nur in Betracht, soweit verfassungsimmanente Güter berührt sind. So folgt etwa aus dem in Art. 7 Abs. 1 GG verankerten staatlichen Erziehungsauftrag die Pflicht des Staates, auch in weltanschaulich-religiöser Hinsicht den Schulfrieden zu gewährleisten (vgl. BVerfGE 108, 282 [303]; 138, 296 [333f. Rn. 99, 335f. Rn. 103, 338 Rn. 108]; BVerwGE 141, 223 [235ff. Rn. 41ff.]; vgl. Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Urteil vom 10. Dezember | |
c) Das normative Spannungsverhältnis zwischen den Verfassungsgütern unter Berücksichtigung des Toleranzgebots aufzulösen, obliegt zuvörderst dem demokratischen Gesetzgeber, der im öffentlichen Willensbildungsprozess einen für alle zumutbaren Kompromiss zu finden hat. Die einschlägigen Normen des Grundgesetzes sind zusammen zu sehen, ihre Interpretation und ihr Wirkungsbereich sind aufeinander abzustimmen (vgl. BVerfGE 108, 282 [302f.]; 138, 296 [333 Rn. 98]). Der Staat muss aber, zumal bei einem weitgehend vorbeugend wirkenden Verbot äußerer religiöser Bekundungen, ein angemessenes Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit und der Schwere des Eingriffs einerseits und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe andererseits wahren (vgl. BVerfGE 83, 1 [19]; 90, 145 [173]; 102, 197 [220]; 104, 337 [349]; 138, 296 [335 Rn. 102]; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 18. Oktober 2016 -- 1 BvR 354/11 --, Rn. 62). Der Glaubensfreiheit der betroffenen Amtsträger kommt hierbei ein hoher Wert zu, zumal sie in enger Verbindung mit der Menschenwürde als dem obersten Wert im System der Grundrechte steht und wegen ihres Ranges extensiv ausgelegt werden muss (vgl. BVerfGE 24, 236 [246]; 35, 366 [375f.]). Folglich unterliegt die Vertretbarkeit der gesetzgeberischen Entscheidung einer eingehenden gerichtlichen Kontrolle (vgl. BVerfGE 45, 187 [238]). Für die Beurteilung der tatsächlichen Gegebenheiten und Entwicklungen, von der abhängt, ob Werte von Verfassungsrang eine Regelung rechtfertigen, die Justizangehörige aller Bekenntnisse zu äußerster Zurückhaltung in der Verwendung von Kennzeichen mit religiösem Bezug verpflichtet, verfügt er allerdings weiterhin über eine Einschätzungsprärogative (vgl. BVerfGE 108, 282 [310f.]; 138, 296 [335 Rn. 102]).
| |
Hiervon ausgehend ist der angegriffene Beschluss des Verwal | |
aa) Für die Position der Beschwerdeführerin spricht, dass das Kopftuch für sie nicht lediglich ein Zeichen für ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Gruppe ist, welches -- wie etwa das Kreuz an einer Halskette -- jederzeit abgenommen werden könnte (vgl. Sinder, ZevKR 63 [2018], S. 170 [203]). Vielmehr stellt das Tragen für sie die Befolgung einer als verbindlich empfundenen Pflicht dar; eine Pflicht, für die es insbesondere im Christentum kein entsprechendes, derart weit verbreitetes Äquivalent gibt. Das allgemeine Verbot religiöser Bekundungen trifft die Beschwerdeführerin daher härter als andere religiös eingestellte, insbesondere christliche Staatsbedienstete (vgl. Berghahn, KJ 2018, S. 167 [175]). Beamte und Richter haben sich zudem in der Regel in Kenntnis der bestehenden Reglementierungen bewusst und freiwillig für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst entschieden. Juristen, die das Zweite Staatsexamen anstreben, bleibt hingegen kein anderer Weg zur Erreichung dieses Ziels als die Absolvierung des Rechtsreferendariats.
| |
bb) Für die Verfassungsmäßigkeit des streitgegenständlichen Verbots spricht indes der Umstand, dass sich das Verbot auf wenige einzelne Tätigkeiten beschränkt, bei denen der Staat den verfassungsrechtlichen Neutralitätsvorgaben den Vorrang eingeräumt hat (vgl. Reus/Mühlhausen, VR 2019, S. 73 [81]). Dies gilt, | |
Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten, die einen vergleichsweise kurzen Zeitraum der Ausbildungsdauer umfassen. Wenngleich die Ausbildungsvorschriften diesen Tätigkeiten einen hohen Stellenwert beimessen (vgl. § 28 Abs. 1 Satz 2 JAG, wonach die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar praktische Aufgaben in möglichst weitem Umfang selbständig und, soweit die Art der Tätigkeit es zulässt, eigenverantwortlich erledigen soll), besteht auf ihre Wahrnehmung jedoch kein Rechtsanspruch. Insbesondere der staatsanwaltschaftliche Sitzungsdienst -- der in der tatsächlichen Praxis die am häufigsten von Rechtsreferendaren übernommene Aufgabe darstellen dürfte, die mit einer Außenwahrnehmung verbunden ist -- wird im maßgeblichen Ausbildungsplan ausdrücklich nicht als "Regelleistung im engeren Sinne" bezeichnet, da er in aller Regel einer konkreten Beurteilung durch die Ausbilderin beziehungsweise den Ausbilder nicht zugänglich sein werde (Zweiter Teil, Abschnitt III des Runderlasses des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 21. Oktober 2014 -- 2220-II/E2-2014/7709-II/E --, JMBl S. 703). Letztlich darf der Umstand, dass vorgesehene Regelleistungen nicht erbracht wer | |
Vor diesem Hintergrund basiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs auf einer verfassungsgemäßen Anwendung des § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 HBG.
| |
II.
| |
Auch die Ausbildungsfreiheit der Beschwerdeführerin aus Art. 12 Abs. 1 GG ist nicht verletzt.
| |
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet allen Deutschen das Recht, die Ausbildungsstätte frei zu wählen. Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Recht der freien Berufswahl, da die Ausbildung in der Regel die Vorstufe einer Berufsaufnahme ist, beide also integrierende Bestandteile eines zusammengehörenden Lebensvorgangs darstellen (vgl. BVerfGE 33, 303 [329f.]; 134, 1 [13f. Rn. 37]). Wenn die Aufnahme eines Berufs -- wie bei Volljuristen (vgl. § 5 Abs. 1, § 9 Nr. 3, § 122 Abs. 1 DRiG, § 4 Satz 1 Nr. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung [BRAO]) -- eine bestimmte Ausbildung voraussetzt, schließt die Nichtzulassung zu dieser Ausbildung aus, diesen Beruf später zu ergreifen (vgl. BVerfGE 33, 303 [330]; 147, 253 [306 Rn. 104]).
| |
Über das -- hier nicht in Rede stehende -- Recht auf Zugang zu einer Ausbildungsstätte hinaus schützt Art. 12 Abs. 1 GG die im Rahmen der Ausbildung notwendigen Tätigkeiten (vgl. allgemein: BVerfGE 33, 303 [329]; in Bezug auf die Teilnahme an Prüfungen während der Ausbildung: BVerfGE 84, 34 [45]; 84, 59 [72]). Hierzu zählt vorliegend auch die Wahrnehmung sitzungsdienstlicher Aufgaben bei Gericht, Staatsanwaltschaft und Verwaltung. Zwar besteht im Rechtsreferendariat, wie dargelegt, kein Anspruch, derartige Aufgaben tatsächlich zu übernehmen. Die einschlägigen Ausbildungsbestimmungen bringen aber zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber derartige Tätigkeiten als zumindest regelmäßig erforderlichen Ausbildungsinhalt betrachtet.
| |
Das gegen die Beschwerdeführerin ausgesprochene und im ver | |
III.
| |
Das Tragen eines Kopftuchs ist Ausdruck der persönlichen Identität der Beschwerdeführerin, die als Teilbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts den Schutz von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG genießt (vgl. BVerfGE 138, 296 [332 Rn. 96]; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 18. Oktober 2016 -- 1 BvR 354/11 --, Rn. 60). Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wirkt in dieser Gewährleistungsvariante insbesondere als Schutz des Selbstbestimmungsrechts über die Darstellung des persönlichen Lebens- und Charakterbildes (Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Abs. 1 Rn. 166 [Juli 2001]; vgl. auch Dreier, in: Dreier, GG, Bd. 1, 3. Aufl. 2013, Art. 2 Abs. 1 Rn. 72; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 15. Aufl. 2018, Art. 2 Rn. 40). Der Einzelne soll selbst darüber befinden dürfen, wie er sich gegenüber Dritten oder der Öffentlichkeit darstellen will und was seinen sozialen Geltungsanspruch ausmachen soll (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 3. November 1999 -- 2 BvR 2039/99 --, Rn. 15; vgl. BVerfGE 35, 202 [220]; 54, 148 [155f.]; 63, 131 [142]; Samour, djbZ 2018, S. 12 [13]).
| |
Der Eingriff in dieses Recht ist jedoch mit den bereits ausgeführten Gründen ebenfalls gerechtfertigt. | |
Ob die Neutralitätsvorgabe des § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 HBG zu einer mittelbaren Benachteiligung der Beschwerdeführerin aufgrund ihres Geschlechts führt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG), bedarf im Ergebnis keiner Entscheidung. Zwar dürfte das § 45 Satz 2 HBG zu entnehmende Verbot bestimmter, insbesondere religiös konnotierter Kleidungsstücke faktisch ganz überwiegend muslimische Frauen treffen, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen (vgl. BVerfGE 138, 296 [354 Rn. 143]). Allerdings ist § 45 Satz 2 HBG lediglich als Konkretisierung der grundlegenden Norm des § 45 Satz 1 HBG konzipiert ("insbesondere"; vgl. auch die Begründung des Gesetzentwurfs, LTDrucks 16/1897 neu, S. 4), der Beamtinnen und Beamte gleichermaßen zu politisch, weltanschaulich und religiös neutralem Verhalten verpflichtet, sodass sich die Neutralitätsvorgabe insgesamt nicht auf das Tragen von Kleidungsstücken beschränkt. Auch der nunmehr maßgebliche Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 24. Juli 2017 -- 2220-II/E2-2017/7064-II/E -- bezieht sich, anders als der vorhergehende Erlass vom 28. Juni 2007 -- 2220-V/A3-2007/6920-V --, nicht ausdrücklich auf das Kopftuch, sondern verpflichtet allgemein zu neutralem Verhalten. Soweit man der Norm aber eine mittelbar diskriminierende Wirkung beimessen wollte, wäre diese aus den Gründen zu rechtfertigen, die auch einen Eingriff in Art. 4 GG tragen können (vgl. BVerfGE 138, 296 [354 Rn. 145]).
| |
V.
| |
§ 45 Satz 3 HBG, auf den sich die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs nicht ausdrücklich stützt, der aber in engem Regelungszusammenhang mit § 45 Satz 1 und 2 HBG steht (vgl. BVerfGE 138, 296 [346 Rn. 123] in Bezug auf den dort zur Prüfung gestellten § 57 Abs. 4 Satz 3 SchulG NW) und von der Beschwerdeführerin ausdrücklich angegriffen wird, steht mit den Regelungen des Grundgesetzes in Einklang, sofern er verfassungskonform angewendet wird.
| |
Nach § 45 Satz 3 HBG ist der christlich und humanistisch ge | |
1. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verlangt, dass niemand wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt wird. Die Norm verstärkt den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG und die durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützte Glaubensfreiheit (BVerfGE 138, 296 [347 Rn. 125]). Hiermit nicht im Einklang stünde ein Verständnis von § 45 Satz 3 HBG, das christliche Symbole vom Anwendungsbereich des Neutralitätsgebots vollständig ausschlösse (vgl. BVerfGE 138, 296 [348 Rn. 127, 371 Rn. 21]). § 57 Abs. 4 Satz 3 SchulG NW, der Prüfungsgegenstand des Beschlusses des Ersten Senats vom 27. Januar 2015 (BVerfGE 138, 296) war, konnte in diesem Sinne verstanden werden, soweit er bestimmte, dass die "Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen [...] nicht dem Verhaltensgebot" widerspricht.
| |
2. § 45 Satz 3 HBG enthält eine derart eindeutige Ausschlussklausel jedoch gerade nicht (vgl. Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Urteil vom 10. Dezember 2007 -- P.St. 2016 --, juris, Rn. 120; Eckertz-Höfer, DVBl 2018, S. 537 [542]). Vielmehr ist die christlich und humanistisch geprägte abendländische Tradition des Landes Hessen ein Belang, der bei der Entscheidung darüber, ob ein Neutralitätsverstoß vorliegt, zu berücksichtigen ist. Von der Prüfung, ob sich die (christliche) Bekundung im Einzelfall insbesondere mit dem Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates in Übereinstimmung bringen lässt, entbindet die Norm nicht. Dies eröffnet die Möglichkeit, Sachverhalte mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund dort gleich zu behandeln, wo dies -- wie im Bereich der Justiz -- verfassungsrechtlich notwendig ist. Ob staatliche Bereiche bestehen, in denen | |
Eine derartige Interpretation hält die Auslegungsgrenzen (vgl. BVerfGE 138, 296 [350 Rn. 132] m.w.N.) ein, da sie vom Wortlaut der Norm gedeckt ist und nicht mit dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch steht. Der Gesetzgeber mag eine Privilegierung christlicher Bekundungen für möglich gehalten haben, hat die Bestimmung der konkret zulässigen Symbole aber der behördlichen Einzelfallentscheidung überantwortet und hierbei zu erkennen gegeben, dass er ein Verbot auch von christlichen Symbolen für zulässig erachtet (vgl. LTDrucks 16/1897 neu, S. 4).
| |
D. | |
Die Auslagenentscheidung beruht auf § 34a Abs. 3 BVerfGG. Gründe, die trotz der Abweisung der Verfassungsbeschwerde für eine Erstattung der Auslagen der Beschwerdeführerin sprechen, liegen nicht vor.
| |
E. | |
Die Entscheidung ist mit 7:1 Stimmen ergangen.
| |
Voßkuhle Huber Hermanns Müller Kessal-Wulf König Maidowski Langenfeld
| |
Der Auffassung des Senats, einer muslimischen Rechtsreferendarin dürfe auf der Grundlage von § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 HBG untersagt werden, bei bestimmten, durch unmittelbaren Kontakt zu den Rechtsschutzsuchenden und | |
Die Senatsmehrheit legt ihrer Entscheidung die Annahme zugrunde, dass die hohen Anforderungen im Hinblick auf politische, religiöse und weltanschauliche Neutralität und auf Unvoreingenommenheit, denen die Tätigkeit im richterlichen und staatsanwaltlichen Amt zu genügen hat, grundsätzlich in vollem Umfang auch für die der Justiz zu Ausbildungszwecken zugewiesenen Absolventinnen und Absolventen der ersten Prüfung (§ 5 DRiG) gelten müssen. Diese Annahme ist in ihrem Grundansatz zwar nicht unplausibel, denn die Verpflichtung des Staates auf Neutralität kann nur durch praktizierte Neutralität seiner Amtsträger wirksam werden. Sie übergeht jedoch Besonderheiten, die die Rolle der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare prägen und die für die verfassungsrechtliche Beurteilung eines an Rechtsreferendarinnen gerichteten "Kopftuchverbots" von entscheidender Bedeutung sind (dazu I.). Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten ergibt sich, dass sich der mit einem "Kopftuchverbot" verbundene Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Referendarinnen nicht rechtfertigen lässt, weil er jedenfalls dem Gebot der Verhältnismäßigkeit nicht genügt (dazu II.). Zu demselben Ergebnis würde man indes sogar auf dem Boden des von der Senatsmehrheit gewählten Ansatzes kommen, weil ein im Vergleich zu der strikten Untersagung religiös begründeter Kleidungsstücke milderes Mittel zur Verfügung stünde (dazu III.). Die Feststellung, dass die angegriffene Entscheidung die Beschwerdeführerin | |
I.
| |
Im Mittelpunkt der Verfassungsbeschwerde steht das an die Beschwerdeführerin gerichtete Verbot, während bestimmter Ausbildungstätigkeiten ihres Vorbereitungsdienstes ein Kopftuch zu tragen oder von diesen im Einzelnen benannten Tätigkeiten ausgeschlossen zu werden, falls sie das Kopftuch nicht abzulegen bereit sein sollte. Dem Senat stehen dabei die im überarbeiteten und auf die Beschwerdeführerin bereits angewendeten Erlass vom 24. Juli 2017 ausdrücklich erwähnten Tätigkeiten -- Sitzungsleitung, Beweisaufnahme, staatsanwaltschaftliche Sitzungsvertretung sowie die Leitung von Anhörungsausschusssitzungen in der Verwaltungsstation -- vor Augen. Zur Rechtfertigung dieser Anordnung stützt sich die Senatsmehrheit im Kern auf drei Gesichtspunkte, nämlich auf das Gebot weltanschaulich-religiöser Neutralität im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst, auf die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, die durch eine "erkennbare Distanzierung des einzelnen Richters und der einzelnen Richterin von individuellen religiösen, weltanschaulichen und politischen Überzeugungen bei der Ausübung ihres Amtes" gestärkt werde, sowie auf die negative Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten. Allerdings ist schon zweifelhaft, ob diese dem Erlass entnommene Aufzählung die Reichweite des § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 HBG zutreffend erfasst (dazu 1.). | |
1. Ob die Beschränkung des streitgegenständlichen "Kopftuchverbots" auf die genannten vier Ausbildungstätigkeiten die Wirklichkeit des Vorbereitungsdienstes vollständig erfasst, ist zweifelhaft, weil die zugrundeliegende beamtenrechtliche Vorschrift, § 45 Satz 1 HBG, politisch, weltanschaulich und religiös neutrales Verhalten "im Dienst" anordnet und auch das Verbot religiös geprägter Kleidungsstücke, Symbole oder anderer Merkmale auf den gesamten Anwendungsbereich dieses Satzes bezieht (§ 45 Satz 2 HBG). Eine Beschränkung auf bestimmte dienstliche Tätigkeiten oder Situationen enthält die Vorschrift nicht; eine solche wird erst durch den konkretisierenden Erlass vorgenommen. Auch der Bezug auf die "objektive" Eignung, das Vertrauen in die Neutralität der Amtsführung zu beeinträchtigen, enthält eine solche Beschränkung nicht. Diese Sicht auf die mit Verstößen gegen die Neutralitätspflicht verbundene Gefahr eines Vertrauensverlusts ist konsequent: Zwar setzt die Gefahr eines Vertrauensverlusts ein Gegenüber voraus -- Rechtsschutzsuchende und Öffentlichkeit --, doch kann sich der allein durch das äußere Erscheinungsbild einer Rechtsreferendarin möglicherweise ausgelöste Eindruck gespaltener oder gegenüber dem religiös neutralen Staat unzureichender Loyalität auch unabhängig davon ergeben, ob die Referendarin in einer konkreten Situation eine aktive Rolle einnimmt oder nicht. Das öffentliche Wissen um die Entscheidung von Gesetzgeber oder Justizverwaltung, Rechtsreferendarinnen die Verwendung religiös begründeter Kleidungsstücke im Dienst zu gestatten, könnte schon für sich genommen einen derartigen Eindruck auslösen. Dieses Verständnis liegt auch dem genannten Erlass zugrunde, der zwar nicht Prüfungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens sein kann, aber als handlungsleitende Auslegung des § 45 HBG für den Dienstherrn der Beschwerdeführerin die Neutralitätspflicht allgemein auf das Verhalten "gegenüber Bürgerinnen und Bürgern" bezieht und ausdrücklich | |
2. Die Übertragung der für richterliche und staatsanwaltschaftliche Tätigkeiten geltenden Anforderungen auf Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare begründet der Senat im Wesentlichen damit, dass eine Rechtsreferendarin für Verfahrensbeteiligte und Öffentlichkeit nicht immer als in der Ausbildung befindlich zu erkennen sei, und dass die angesprochenen Personen ein Anrecht darauf hätten, dass die "justiziellen Grundbedingungen" auch dann zu gelten hätten, wenn der Staat Aufgaben zu Ausbildungszwecken übertrage. Keiner dieser beiden Aspekte trägt jedoch die Position der Senatsmehrheit. Zwar mag der ersterwähnte Aspekt faktisch zutreffen -- besonders dann, wenn eine Rechtsreferendarin in Amtstracht auftritt --, doch wäre es in jedem Anwendungsfall ohne weiteres möglich und geboten (dazu unten Rn. 14, 21f.), die Eigenschaft einer für das Gericht oder die Staatsanwaltschaft auftretenden Person als Rechtsreferendarin durch einen entsprechenden Hinweis für alle Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit unmissverständlich deutlich zu machen. Ohnehin entspricht es zunehmend der modernen Praxis in der Justiz, dass sich Repräsentanten der Gerichte oder Staatsanwaltschaften den Verfahrensbeteiligten mit ihrer Dienstbezeichnung vorstellen und auf diese Weise deutlich machen, in welcher Eigenschaft sie ihre Tätigkeit ausüben.
| |
Nichts anderes gilt im Ergebnis für den von der Senatsmehrheit zu Recht hervorgehobenen Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf eine umfassend neutrale und unvoreingenommene Amtsführung der in ihrer Sache tätigen Repräsentanten der Justiz. Das | |
Die Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist es, Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare auf die zweite Staatsprüfung und damit auf ihre künftige Rolle als Volljuristen in mannigfachen beruflichen Zusammenhängen vorzubereiten. Sie zielt einerseits darauf, dass richterliche und staatsanwaltliche Tätigkeit "eingeübt" und den Betroffenen das Bewusstsein für die Strenge der diesen Ämtern eigenen Anforderungen an Neutralität und Unvoreingenommenheit nicht nur theoretisch, sondern als Ergebnis eigener Erfahrung vermittelt wird. Andererseits muss -- anders als dies bei Richterinnen und Richtern auf Probe oder in der Anfangsphase des staatsanwaltlichen Dienstes der Fall ist -- die übertragene Tätigkeit laufend und in jeder Phase der Ausbildung unter Kontrolle gehalten werden, gerade dort, wo den Referendarinnen und Referendaren ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit auferlegt wird. Richterliche Unabhängigkeit und die volle staatsanwaltliche Verantwortung kommt ihnen gerade nicht zu (vgl. § 10, § 142 Abs. 3 GVG). Deshalb bedürfte jeder Ansatz, der die mit dieser Unabhängigkeit und Verantwortung verbunde | |
II.
| |
Mit der Senatsmehrheit ist davon auszugehen, dass das Verbot, bei bestimmten Tätigkeiten im Vorbereitungsdienst ein Kopftuch zu tragen, andernfalls diese Tätigkeiten zu unterlassen, einen Eingriff in die Ausbildungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und in die Glaubensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) der Rechtsreferendarin darstellt, und dass dieser Eingriff schon wegen der engen Verbindung zwischen der schrankenlos gewährleisteten Glaubensfreiheit und der Menschenwürde als dem obersten Wert im System der Grundrechte schwer wiegt. Der Eingriff ist verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Ausgehend von dem zutreffenden Prüfungsmaßstab (dazu 1.) und unter Einbeziehung aller relevanten Gesichtspunkte (dazu 2.) überwiegen die gegen ein "Kopftuchverbot" im Vorbereitungsdienst sprechenden Belange (dazu 3.). | |
1. Den Maßstab für die Frage, welche verfassungsrechtlichen Belange in die Prüfung der Rechtfertigung des streitgegenständlichen Grundrechtseingriffs einzustellen sind, stellen mit je gleicher Relevanz für den vorliegenden Fall und sich wechselseitig ergänzend Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 4 Abs. 1 und 2 GG dar. Eine isolierte Prüfung nur am Maßstab des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG würde außer Acht lassen, dass die Ausbildungssituation des Vorbereitungsdienstes Gewicht und Reichweite der maßgeblichen Belange entscheidend prägt; eine isolierte Prüfung nur am Maßstab des Art. 12 Abs. 1 GG wäre defizitär, weil sie das Gewicht der Grundrechtsgewährleistung des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG nur schwer zutreffend erfassen könnte. Der Ansatz der Senatsmehrheit, die im Rahmen von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG angestellten Überlegungen ohne hinreichend differenzierte zusätzliche Erwägungen auf die Rechtfertigung auch des Eingriffs in Art. 12 Abs. 1 GG zu übertragen, wird jedenfalls nicht durch den Umstand getragen, dass die Glaubensfreiheit vorbehaltlos gewährleistet ist, die Ausbildungsfreiheit hingegen nicht. Richtig ist zwar, dass Art. 4 Abs. 1 und 2 GG als Gewährleistung ohne Schrankenvorbehalt besondere Bedeutung zukommt; unter diesem Blickwinkel trifft die Annahme des Senats zu, dass die Ausbildungsfreiheit keinen weitergehenden Schutz garantieren kann als die Glaubensfreiheit. Für die Prüfung des streitgegenständlichen Grundrechtseingriffs von größerer Bedeutung ist indes der Umstand, dass die Schutzrichtungen der beiden Grundrechte sich nicht decken und dass die Beschwerdeführerin sich nach ihrem Vortrag in erster Linie in ihrer Ausbildungsfreiheit verletzt sieht. Zur Rechtfertigung eines Eingriffs in Art. 12 Abs. 1 GG können daher nicht dieselben Überlegungen vorgebracht werden wie im Rahmen der Prüfung des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG.
| |
2. Über die von der Senatsmehrheit als maßgebliche Verfassungsgüter herangezogenen Gesichtspunkte hinaus ist in die Prüfung der Rechtfertigung des durch ein "Kopftuchverbot" bewirkten Grundrechtseingriffs einzubeziehen, dass betroffene | |
Bei dem Vorbereitungsdienst handelt es sich um ein Ausbildungsmonopol, das der Staat für sich in Anspruch nimmt. Der Vorbereitungsdienst mit der anschließenden zweiten Staatsprüfung ist gemäß § 5 Abs. 1 DRiG Voraussetzung nicht nur für die Befähigung zum Richteramt, sondern auch für weitere juristische Berufe, auch für solche, die außerhalb des Staatsdienstes ausgeübt werden (vgl. § 122 Abs. 1 DRiG, § 4 Satz 1 Nr. 1 BRAO, § 5 Satz 1 BNotO; vgl. auch EuGH, Urteil vom 10. Dezember 2009 -- C-345/08 --, juris, Rn. 27). Volljuristinnen und Volljuristen finden ungeachtet des Strukturwandels, der die akademischen Ausbildungsgänge generell seit 1999 betrifft ("Bologna-Prozess" zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums), und ungeachtet der Vielzahl an mittlerweile verfügbaren spezialisierten juristischen akademischen Abschlüssen auch weiterhin hoch qualifizierte Tätigkeiten im Bereich der Wirtschaft, der Banken, des Versicherungswesens, der Handelskammern, anderer öffentlich-rechtlicher Kammern, der Verbände, der Gewerkschaften und in der staatlichen Verwaltung. Dabei gehört der Vorbereitungsdienst für zahlreiche Berufe nach wie vor in der Wahrnehmung der betroffenen Kreise zu einer "abgeschlossenen Berufsausbildung" und stellt zugleich einen verlässlichen Ausweis über die erworbene -- vielseitige -- Qualifikation als "Einheitsjurist" dar (vgl. BVerfGE 39, 334 [372f.]; vgl. auch BVerfGE 33, 44 [50]).
| |
Rechtsreferendarinnen, die wie die Beschwerdeführerin das Tragen eines Kopftuchs aus religiösen Gründen für sich selbst als zwingend empfinden, wird zwar nicht der Zugang zum Vorbereitungsdienst oder zur zweiten Staatsprüfung unmöglich gemacht. Seit der Änderung des Erlasses vom 28. Juni 2007 durch den Erlass vom 24. Juli 2017 soll sich ihre Weigerung, das Kopftuch während bestimmter Ausbildungssituationen abzulegen, auch nicht mehr auf die Stationsnote oder das Prüfungsergebnis auswirken; praktisch wird dies allerdings dazu führen, dass das Fehlen bestimmter Ausbildungstätigkeiten zwar nicht negativ gewer | |
3. Eine vor diesem Hintergrund durchgeführte Verhältnismäßigkeitsprüfung führt zu dem Ergebnis, dass das gegen die Beschwerdeführerin gerichtete "Kopftuchverbot" verfassungsrechtlich nicht haltbar ist. Denn den von der Senatsmehrheit in den Vordergrund gerückten Belangen -- weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates, Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, negative Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten -- kommt im Kontext des Art. 12 Abs. 1 GG ein erheblich geringeres Gewicht zu als der Senat annimmt, während die Auswirkungen der zur Prüfung stehenden Maßnahme auf die Ausbildungsfreiheit der Beschwerdeführerin deutlich stärker zu gewichten sind. Daher kann offenbleiben, ob aufgrund der im Folgenden aufgeführten Erwägungen auch die Eignung sowie die Erforderlichkeit des "Kopftuchverbots" zur Erreichung des gesetzgeberischen Ziels in Zweifel zu ziehen wären. Zu prüfen sind zwei Perspektiven: Referendarinnen, die aus religiöser Überzeugung das Kopftuch tragen, könnten gegen das für sie selbst ebenfalls geltende Neutralitätsgebot verstoßen und schon dadurch das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates beschädigen, oder sie könnten Verfahrensbeteiligte und Öffentlichkeit durch ihr sichtbares Bekenntnis zu ihrer Religion zu dem Schluss verleiten, dass auch die dauerhaft tätigen Richterinnen eines Gerichts oder Staatsanwältinnen sich mit einer Abkehr vom Neutralitätsgebot abfinden oder gar identifizieren.
| |
Die von der Senatsmehrheit angeführten Belange sind zwar legitime Regelungsziele. Sie lassen sich jedoch zur Einschränkung der freien Religionsausübung sowie der Ausbildungsfreiheit gegenüber einer im Vorbereitungsdienst befindlichen Rechtsreferendarin nicht mit dem Gewicht anführen, das die Senatsmehrheit ihnen zumisst. Denn Rechtsreferendarinnen, die sich durch religiös konnotierte Kleidung äußerlich erkennbar zu ihrer Religion bekennen, können die genannten Belange deutlich weniger beeinträchtigen als dies in der Wahrnehmung objektiver Betroffener unabhängige Richterinnen oder Repräsentantinnen der | |
Dasselbe gilt für das -- ebenfalls legitime -- Ziel, das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Justiz zu erhalten. Der Senat hebt hervor, dass dieses Vertrauen dadurch gestärkt werden könne, dass eine muslimische Richterin bei Ausübung ihres Amtes auf die öffentliche Kundgabe von Religiosität verzichte, ebenso wie Vertrauen verloren gehen mag, wenn eine Richterin eine solche Distanzierung ablehnt. Dass Verfahrensbeteiligte oder die Öffentlichkeit das Auftreten einer nur vorübergehend und nur zu Ausbildungszwecken in der Justiz tätigen Rechtsreferendarin in der gleichen Weise gewichten könnten wie das Verhalten einer Richterin oder Staatsanwältin, ist hingegen nicht anzunehmen. Denn mit dem -- wiederum ist hervorzuheben: für alle Beteiligten erkennbaren -- Aspekt der bloßen Ausbildung im Rahmen von Gericht oder Staatsanwaltschaft verbunden ist das Bewusstsein, dass jede geprüfte Rechtskandidatin gezwungen ist, in den Vorbereitungsdienst einzutreten, wenn sie anschließend als Volljuristin -- und sei es auch außerhalb des Staatsdienstes -- tätig sein will. Dieser Situation einer bloßen Ausbildung entspricht es, dass keine der einer Rechtsreferendarin übertragenen Aufgaben die rechtsprechende Tätigkeit als solche betrifft. Diese verbleibt -- wie die Verantwortung für das Handeln der zur Ausbildung zugewiesenen Referendarinnen und Referendare -- zu jedem Zeitpunkt bei dem gesetzlichen Richter des jeweiligen Verfahrens.
| |
Mit geringen Abweichungen gilt Vergleichbares schließlich auch für den von der Senatsmehrheit angeführten Gesichtspunkt der negativen Religionsfreiheit. Hier ist davon auszugehen, dass eine das Kopftuch tragende Referendarin wegen der auch ihr grundsätzlich obliegenden Neutralitätspflicht jede aktive, über ihre bloße äußere Erscheinung hinausgehende Werbung für ihre Religion zu unterlassen hat, also lediglich aufgrund der von ihr als zwingend empfundenen Entscheidung für das Kopftuch als religiös orientiert erkennbar ist. Die darin liegende Wirkung auf Ver | |
Deutlich höheres Gewicht haben demgegenüber die individuelle Glaubensentscheidung der betroffenen Rechtsreferendarinnen sowie ihr Anspruch auf eine inhaltlich umfassende Ausbildung, die ein realistisches Bild von den durch die zweite Staatsprüfung zugänglichen Berufen auch innerhalb der Justiz vermittelt. Die als individuell zwingend empfundene Entscheidung für eine bestimmte, religiös begründete Kleidung genießt den Schutz der Religionsfreiheit und ist, wie auch die Senatsmehrheit hervorhebt, als gewichtig einzustufen. Dasselbe gilt aus den erwähnten Gründen aber auch für das Interesse an einer Ausbildung, die all das bietet und enthält, was auch Referendarinnen und Referendare ohne eine äußerlich sichtbare Hinwendung zu ihrer Religion in Anspruch nehmen können. Der partielle Ausschluss von einem Teil dieser Ausbildung bewirkt ungeachtet des Umstands, dass er sich auf die Leistungsbewertung nicht negativ auswirken soll, einen spürbaren Verlust an Ausbildungsqualität, weil er den Betroffenen gerade das Element des Selbstständigen und Praxisbezogenen vorenthält, das den Vorbereitungsdienst gegenüber dem zuvor abgeschlossenen Studium auszeichnet.
| |
Das Interesse daran, einem Glaubensgebot folgen zu dürfen, sowie daran, die erforderliche, beim Staat monopolisierte Ausbildung in vollem Umfang erfahren zu können, setzt sich gegenüber den nur relativ geringfügig betroffenen Belangen, denen die Senatsmehrheit das entscheidende Gewicht zugewiesen hat, durch. Allerdings hängt die Plausibilität und Handhabbarkeit dieses Abwägungsergebnisses, wie ausgeführt, davon ab, dass die Rolle ei | |
III.
| |
Unabhängig von den vorerwähnten Erwägungen würde auch eine auf dem Boden der von der Senatsmehrheit für richtig gehaltenen überwiegenden oder ausschließlichen Orientierung an der Glaubensfreiheit beruhende Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass das Verbot, in bestimmten Situationen im Vorbereitungsdienst ein religiös begründetes Kopftuch zu tragen, unverhältnismäßig ist, dass also der darin liegende Eingriff in die Glaubensfreiheit verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt ist. Denn statt eines weitreichenden und strikten Verbots steht ein milderes Mittel zur Erreichung des angestrebten Ziels zur Verfügung, so dass sich ein Verbot als nicht erforderlich erweist.
| |
Die von der Senatsmehrheit befürchteten negativen Auswirkungen einer Beschäftigung von Rechtsreferendarinnen, die im Vorbereitungsdienst ein religiös begründetes Kopftuch tragen, auf die Grundsätze der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie auf die negative Religionsfreiheit Dritter dürften wesentlich von einem Moment der Unkenntnis bei Verfahrensbeteiligten und Öffentlichkeit bestimmt werden. Der -- für die Justiz sicherlich problematische -- Eindruck, der Staat vollziehe ausgerechnet im Bereich der Rechtspflege eine Abkehr von seiner verfassungsrechtlich fundierten Pflicht, religiös-weltanschauliche ebenso wie politische Neutralität zu wahren, entsteht, wie die Senatsmehrheit ausführt, vorwiegend aus einem Akt der Zurechnung: "Aus Sicht des objektiven Betrachters kann insofern das Tragen eines islamischen Kopftuches durch eine Richterin oder eine Staatsanwältin während der Verhandlung als Beeinträchtigung der weltanschaulich-religiösen Neutralität dem Staat zugerechnet werden". Wenn also Verfahrensbeteiligte und Öffentlichkeit als Folge einer Fehleinschätzung -- indem sie eine selbstständig agierende Rechts | |
Abgesehen davon, dass ein an Referendarinnen gerichtetes "Kopftuchverbot" nur bedingt geeignet sein mag, diese Wirkung zu unterbinden, da es sich nicht auf Richterinnen und Staatsanwältinnen erstreckt, ist es aber vor allem nicht erforderlich. Denn es ist ein milderes Mittel verfügbar, die erwähnte Fehlvorstellung bei Verfahrensbeteiligten und Öffentlichkeit zuverlässig zu vermeiden. Einer möglichen Identifizierung des Staates mit der Glaubensüberzeugung einer muslimischen Rechtsreferendarin kann bereits dadurch wirksam begegnet werden, dass in jedem Einzelfall gegenüber den Verfahrensbeteiligten oder der Öffentlichkeit auf die Rechtsstellung der im justiziellen Bereich mit Kopftuch auftretenden Referendarin und damit auf das bestehende Ausbildungsverhältnis ausdrücklich hingewiesen und die damit verbundene Problematik bei Bedarf erläutert wird. Ein solcher Hinweis kann im Fall der unter Aufsicht geführten Sitzungsleitung oder Beweisaufnahme und, soweit die Referendarin lediglich neben dem zur Entscheidung berufenen Spruchkörper auf der Richterbank sitzt, durch die Ausbilderin oder den Ausbilder gegeben werden -- wie dies im Übrigen praktisch ohnehin meist geschieht, wenn Rechtsreferendaren und Rechtsreferendarinnen Tätigkeiten mit unmittelbarem Kontakt zu Verfahrensbeteiligten übertragen werden. Andernfalls, soweit eine Referendarin ohne anwesende Ausbilder selbstständig auftritt, hat sie selbst die Verfahrensbeteiligten oder die Öffentlichkeit über ihre Rolle zu unterrichten. Soweit im Rahmen des staatsanwaltlichen Sitzungsdienstes keine Aufsicht durch anwesende Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen vorgeschrieben ist oder praktiziert wird, kann der Hinweis durch den die Sitzung leitenden Richter oder die zuständige Richterin erfolgen. Im Übrigen bestehen weitere techni | |
Eine solche Kennzeichnung hat zur Folge, dass den Verfahrensbeteiligten und der anwesenden Öffentlichkeit klar vor Augen steht, dass sie keine unabhängige Richterin oder Amtsträgerin der Staatsanwaltschaft vor sich haben, die ihre Religionszugehörigkeit deutlich zu erkennen gibt, sondern eine Ausbildungssituation unter Verantwortung und Aufsicht von Gericht und Staatsanwaltschaft. Mit einer unmissverständlichen Unterrichtung der Beteiligten über die Rolle der Rechtsreferendarin in einer konkreten Verfahrenssituation wird der "objektive Betrachter" nicht mehr dem Irrtum unterliegen können, der Staat identifiziere sich mit einem Bekenntnis zu einer bestimmten Religion oder müsse sich das Auftreten einer Rechtsreferendarin mit Kopftuch zurechnen lassen.
| |
IV.
| |
Im Ergebnis führen diese Erwägungen nach meiner Auffassung zu der Feststellung, dass der angegriffene Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs die Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten aus Art. 12 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verletzt. Der Fall gibt jedoch keine Veranlassung, die entscheidungstragenden Vorschriften -- § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG sowie § 45 HGB -- als verfassungswidrig einzustufen. Schon § 27 Abs. 1 Satz 2 JAG, wonach für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis mit wenigen Ausnahmen die Vorschriften für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf "entsprechend" anwendbar sind, ermöglicht es, die Besonderheiten der zu regelnden Sachverhalte -- insbesondere den Charakter des Vorbereitungsdienstes als einziger Zugang zu allen Berufen, die die Befähigung zum Richteramt voraussetzen -- bei der Bestimmung der Reichweite der Verweisung angemessen zu berücksichtigen. § 45 HBG als die in Bezug genommene, für alle Beamtinnen und Beamte geltende Norm bezieht sich in seinem Satz 2 nur auf solche Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale, die "objektiv geeignet" sind, das Vertrauen in die | |
Zusätzlich und hiervon unabhängig drängt sich aufgrund der vorstehenden Überlegungen die Möglichkeit und Notwendigkeit einer verfassungskonformen Auslegung des § 45 Satz 2 HBG auf, wie sie der Senat zu Recht auch bei § 45 Satz 3 HBG für geboten hält. Unter Berücksichtigung des grundrechtlichen Gehalts der Ausbildungsfreiheit in Art. 12 Abs. 1 GG spricht Überwiegendes dafür, die Vorschrift für Personen, die sich in einer staatlich monopolisierten Ausbildung befinden, einschränkend dahin auszulegen, dass ein Verbot gegenüber solchen Personen wegen der zeitlichen Begrenztheit jeder Ausbildung überhaupt nicht oder doch nur aufgrund einer besonders strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung zulässig sein kann. Besteht hingegen die Möglichkeit, den Kontext einer von einer Rechtsreferendarin durchgeführten Amtshandlung zu einer Ausbildung in irgendeiner Weise deutlich zu machen, so kommt ein Verbot religiös geprägter Kleidung oder entsprechender Symbole oder Merkmale nicht in Betracht. Im praktischen Ergebnis führt dies dazu, dass ein Verbot wie das gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochene im Regelfall ausscheiden muss.
| |
Mit einer solchen Auslegung ist keine Vorentscheidung darüber getroffen, wie über die Verwendung religiös begründeter Kleidung oder entsprechender Symbole oder Merkmale durch Richterinnen und Richter auf Probe, auf Zeit oder auf Lebenszeit, durch | |
V.
| |
Die weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates erfordert eine offene, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde tolerante Haltung. Diese Haltung ist nicht nur als eine statische zu verstehen, sondern muss als ein wesentliches Element auch die Bereitschaft einschließen, Offenheit für gesellschaftliche und politische Entwicklungen zu bewahren, scheinbar fest gefügte Positionen in Frage stellen zu lassen und auf neue Problemstellungen auf dem Boden der Verfassung angemessen zu reagieren. Dass dies im praktischen Alltag schwierig ist, hat nicht zuletzt die langjährige Auseinandersetzung über den Umgang mit religiös begründeter Kleidung und Symbolen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Frage, ob in einem quantitativ untergeordneten Arbeitsbereich der Justiz, der Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, erkennbar religiös geprägte Menschen einen partiellen Ausschluss von Teilen der für sie selbst, aber auch für die Gesellschaft insgesamt wichtigen Ausbildung hinnehmen müssen, lässt sich -- wie der vorliegende Fall zeigt -- unterschiedlich beantworten; allerdings fehlt es vielfach noch an gesicherten empirischen Grundlagen über Art und Wahrschein | |